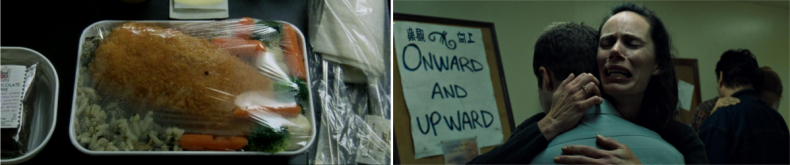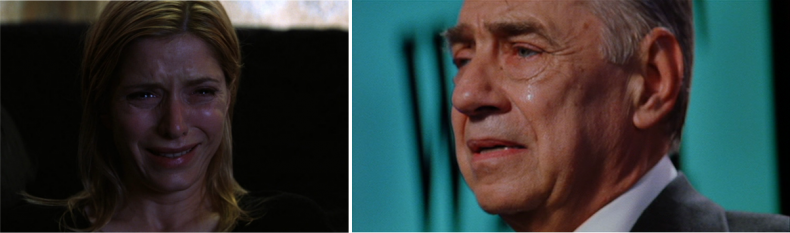Lightleid.
Lightleid.
FIGHT CLUB, MAGNOLIA und die tränenreiche Sehnsucht nach Eindeutigkeit
C’est l’Ennui! L’œil chargé d’un pleur involontaire,Il rêve d’échafauds en fumant son houka.
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
— Hypocrite lecteur, — mon semblable, — mon frère!Die Langeweile ists! — Das Auge schwer von willenloser Träne,
träumt von Blutgerüsten, ihre Wasserpfeife schmauchend; du
kennst es, Leser, dieses zarte Scheusal, — scheinheiliger Leser, —
Meinesgleichen, — mein Bruder!(Charles Baudelaire, Au lecteur1)
Die Frage ist ja nicht, warum wir im Kino weinen, sondern warum wir es gerne tun. Schließlich geschieht es mit Absicht. Wir wußten es vorher; wir zahlen auch noch dafür. Suchen wir die süße, schläfrige Entspannung, mit der wir da aus der Dunkelheit tapsen? Das aufgeräumte Gefühl, schwebend und warm und gar nicht richtig da zu sein, nachdem der Brustkorb sich schnürte, aufsteigend gegen Kehle und Augenhöhlen preßte, um sich endlich stoßweise wieder zu lösen?
Oder sind es die gravitätischen Griechen: Horror, Terror und Katharsis? Wo es um die Erklärung der Tränen geht, erfreut sich Aristoteles ungebrochener Beliebtheit. Demnach stecken wir voller unsinniger Gefühle und benötigen regelmäßig "eine Reinigung von derartigen Erregungszuständen" (Aristoteles 1994, 19).2
Schon Hippokrates sah in den Tränen "Körpersäfte aus dem Gehirn" (zitiert in Lutz 2000, 78),3 deren Übermaß purgiert werden müsse. Auch Breuer und Freud waren in ihren Studien über Hysterie eifrige Aristoteles-Schüler.4 Heute schwören fast alle 'körperorientierten' und viele humanistische Psychotherapien auf das Aufspüren und Freilassen unterdrückter Gefühle als Universallösungsmittel für Traumata, Verhaltensmuster, falsche Selbste, Charakterpanzer etc. Denn im Gefühl haben wir angeblich spontanen Kontakt zu unserem wahren Selbst (vgl. Lutz 2000: 144ff.). So sprechen sie alle auf die eine oder andere Weise Rousseau nach. Die 'böse' Gesellschaft in Gestalt der 'bösen' Eltern verweigert das Ausleben unserer 'nur natürlichen Gefühle', einschließlich der Trauer über diese frühen, schweren Verletzungen.
Die Sprache ist verführerisch; man nimmt die Träne gern beim Wort. Da wird überall 'abgelassen', was sich 'aufgestaut' hat, da 'kommt alles raus' und 'verflüssigt' sich, 'klärt' und 'wäscht den Blick frei'.5 Als spräche unser Körper in Metaphern. Als sonderten wir ein beständiges Rinnsal Gefühle in gewisse Kammern unseres Hirnes, die, zu Karfunkeln verkrustet, aufs Gemüt drücken. Wir schleppen unsere Seelen ins Kino wie pralle Blasen zum Pissoir.
Dieser Text vertritt das Gegenteil. Tränen leeren nichts (vielleicht haben sie das früher getan), sie füllen eine Leere. Vielleicht war die viktorianische Seele tatsächlich ein Dampfkessel kurz vor der Explosion. Aber wenn uns heute eine Technologie ein Bild unserer Psyche an die Hand gibt, dann ist das weder die Hydraulik, noch das Grammophon oder der Computer, sondern die Vakuumglocke. Weinen im Kino — das ist die These, die ich hier entwickeln möchte — ist heute eine Lösungsstrategie der Leere. Im Weinen finden wir ein verdichtetes Bild des Kinos selbst: Beide sind kontrollierte Kontrollverluste.
Von welcher Leere spreche ich? Wie ist sie entstanden? Und mit welchen Mitteln versuchen wir ihr zu entkommen?
1884 erscheint in Paris A rebours von Joris-Karl Huysmans. Sein Held des Esseintes, Hypochonder und Misanthrop, ausgedünnter letzter Sproß eines Adelsgeschlechtes, bedrückt "ein gewaltiger Überdruß" (Huysmanns 1992, 54). Nicht einmal "die heftigsten und schärfsten Rasereien des Fleisches" (ebd., 40) können seine abgestumpften Sinne noch erregen. Er zieht sich auf sein Landhaus in eine Kunstwelt zurück, die seinen überfeinerten Geschmack vor der Plumpheit der Mitmenschen bewahren soll. Das Experiment scheitert, des Esseintes fiebert, kann nichts mehr essen, erleidet Schwächeanfälle. Kurz vor der Rückkehr in die Pariser Gesellschaft ruft er aus: "Nun krache doch zusammen, Gesellschaft, stirb doch, alte Menschheit!" (ebd., 249). Existentieller Überdruß, Daseinsekel, Langeweile — Baudelaire gab dem Lebensgefühl des Fin de siècle Jahrzehnte vor Huysmans einen Namen: Ennui.
Während des Esseintes sein Heil noch in einer wohltemperierten Kunstwelt suchte, ist es heute deren Allgegenwart, die unseren Ekel schürt. Die Welt ist vollisoliert und teflonbeschichtet. Der materielle Überfluß macht uns selber überflüssig; im flexiblen Kapitalismus lösen sich alle gesellschaftlichen Strukturen und Werte auf. (vgl. Sennett 200) Selbst die Geschichte gibt keine Orientierung mehr her. Wie es in FIGHT CLUB (1999) heißt: "We're the middle children of history, men. No purpose or place. We have no great war, no great depression." Statt dessen gibt es das Leben vorportioniert und eingeschweißt an der Tiefkühltheke, ein Fertiggericht, convenient, jeder materiellen Schwere, jedem Schmutz, aller Höhen und Tiefen, Klangspitzen und Klarheit beraubt wie ein schlecht gesampelter MP3-Track.
Parallel dazu dröhnt 24 Stunden am Tag ein hypertrophes Hintergrundrauschen in Cinemascope und Dolby Digital. Bevor wir irgend etwas erleben, haben wir es hundertmal und hundertmal besser in den Medien gesehen. Während die Medien alles darstellen dürfen — die Freiheit der Rede kennt keine Grenze — hegt der Prozeß der Zivilisation das eigene Leben in immer engere Grenzen. Er bewirkt nicht nur eine "Dämpfung der spontanen Wallungen, Zurückhaltung der Affekte, Weitung des Gedankenraums über den Augenblick hinaus". (Elias 1994, 2, 322) Er wendet nicht nur das Fühlen und Denken auf sich selbst, bis wir zu keiner klaren Empfindung mehr in der Lage sind.6 Er zwingt uns nicht nur in den permanenten reflexiven Abstand zu jedem Geschehen. (vgl. Giddens 2001) — Er mediatisiert das Handeln selbst. An die Stelle der seeligen Erschöpfung körperlicher Arbeit treten Meetings, PowerPoint-Präsentationen, E-mails und Flipcharts mit Strukturplänen. Sprache ersetzt Handeln. Statt zu schlagen drohe ich, statt dich anzufassen, scherzen wir. Das erspart uns die Gefahr wirklicher Demütigung und wirklicher Schmerzen. Das geht nur solange gut, wie wir in die unverbrüchliche Bindung zwischen Wort und Handlung vertrauen.
Der Psychoanalytiker Finn Skårderud schreibt in seinem Buch Unruhe über den modernen Menschen: "Sein Abstand zur sogenannten Wirklichkeit in Form der Natur hat deutlich zugenommen. [...] [Das] kann zu einem Gefühl der Unwirklichkeit führen, was einen Hunger nach Wirklichkeit hervorruft. Es entsteht eine Sehnsucht nach Leben, Präsenz und Reibung." (Skårderud 2000, 386) Es stellt sich nur eine Frage: Wozu dann noch Tränen?
1996 erscheint in englischer Sprache Fight Club von Chuck Palahniuk, drei Jahre später folgt die Verfilmung. Ihr Erzähler, bläßlich und namenlos, arbeitet als "Koordinator für Rückrufaktionen" (Palahniuk 1999, 30) bei einem amerikanischen Automobilkonzern. Seine Heimat sind Flughäfen, Hotels für Geschäftsleute, Bürozellenkolonien und ein Appartement mit Kompletteinrichtung von Ikea. Seine Arbeit besitzt keinerlei moralischen Wert, sie bedeutet ihm sowenig, wie er für sein Unternehmen gänzlich austauschbar ist. Er besitzt keine Beziehungen außer den "Einwegfreunden" seiner Flüge. Er ist ein Mann ohne Eigenschaften, der Prototyp des flexiblen Menschen. Er ist die Leere in Person.
Und er hat ein Problem. Er kann nicht schlafen: "Alles ist so weit weg, die Kopie einer Kopie einer Kopie. Mit dem Abstand der Schlaflosigkeit kannst du nichts berühren, und nichts kann dich berühren" (ebd., 19). Nach drei Wochen ohne Schlaf sucht er einen Arzt auf. Der rät ihm, er solle sich nicht anstellen, schließlich fehle ihm rein körperlich nichts — wenn er sehen wolle, was echtes Leid sei, solle er mal zu einer Selbsthilfegruppe gehen. "Mir die Gehirnparasiten ansehen. Die degenerativen Knochenerkrankungen. Die organischen Gehirnstörungen. Mir ansehen, wie die Krebspatienten zurechtkommen. Also ging ich hin" (ebd., 17).
So absurd die Entscheidung anmutet, im Elend der anderen, in der therapeutischen Umarmung findet er tatsächlich Erlösung: "[J]ede Woche schlingt Bob seine Arme um mich, und ich weine. [...] Weinen ist leicht in der stickigen Dunkelheit, in den Armen eines anderen, wenn du siehst, das alles, was du jemals erreichen kannst, als Abfall enden wird" (ebd., 14f.). Unter falschen Namen schleicht er sich nun regelmäßig in verschiedene Selbsthilfegruppen. Er wird regelrecht abhängig. "Wenn ich in einer Gruppe nichts sagte, nahmen die Leute das Schlimmste an. Sie weinten noch heftiger. Ich weinte heftiger. [...] Wenn ich nach einer Selbsthilfegruppe nach Hause ging, fühlte ich mich lebendiger als je zuvor. [...] Und ich schlief. Nicht einmal Babys schlafen so gut" (ebd., 21).
Das Leid und das Weinen besitzen alles, was der Leere fehlt: Eindeutigkeit. Wahrheit. Bedeutung. Körper. Gefühl. Wirklichkeit. Glücklich, wer ein Trauma hat; er besitzt einen Fixpunkt, mit etwas therapeutischer Hilfe sogar eine Geschichte. Der Erzähler sucht die Tränen, weil sie kein Ersatz oder Zeichen von etwas sind, sondern die Sache selbst. Bereits 1950 bemerkte Helmuth Plessner, Tränen seien elementar nichtsprachlich. Lachen und Weinen sind für ihn rein "expressiv-reaktive" Ausdrucksgebärden, ihnen fehlt jede "dem Lachenden oder Weinenden bewußte Zeichenfunktion". (Plessner 1950, 67) "Die Unmittelbarkeit und Unwillkürlichkeit des mimischen Ausdrucks zeigt sich an der Unvertretbarkeit der Ausdrucksbewegung gegenüber dem Ausdrucksgehalt", "jene Indifferenz zwischen Inhalt und Form, die es verbietet, sie in einem Verhältnis äußerlicher Verknüpfung zu sehen" (ebd., 71f.).
Zwar wurden Tränen zu unterschiedlichen Zeiten und Orten die verschiedensten Bedeutungen zugeschrieben, waren sie wechselweise heilig oder betrügerisch, geziemend oder unschicklich, Zeichen hoher Moralität wie selbstbezüglicher Gefühlsduselei. Die Bewertung der Tränen ist zu einem gewissen Teil kulturelle Konvention. Sicher besitzt das Weinen auch sprachliche Funktion, in dem Sinne, daß wir es lesen können wie eine Sprache. Für den Weinenden aber — das ist das Entscheidende — lassen sich Weinen und Fühlen nicht trennen. Im Gegensatz zum sprachlichen Zeichen können wir nicht frei darüber verfügen. Wir können zu jedem beliebigen Zeitpunkt sagen: "Ich bin traurig." Gerade die Leichtigkeit, mit der wir jeden Satz sagen können, unabhängig von seiner Wahrheit oder unserer tatsächlichen Überzeugung, macht uns die Sprache ja so verdächtig (im Sinne von Ecos Definition, ein Zeichen sei das, womit man lügen könne). Aber wir können nicht willentlich weinen. Tränen brauchen stets einen Anlaß.
Dem widerspricht auf den ersten Blick jeder Schauspieler, der in seiner Rolle weint. Aber der Schauspieler hat gelernt, seinen Körper zu domestizieren und künstlich zu weinen. Und Stanislawski und Lee Strassberg liefern ihm "the Method" dazu (vgl. Lutz 2000, 109f.). Über die Imitation von Körperhaltung, Atmung, Gedanken und erinnertem Körpergefühl soll der Schauspieler sich möglichst vollständig in eine tränenreiche Situation der Vergangenheit versetzen. Dahinter steht die Annahme, Gefühle seien eine komplexe Ganzheit aus Gedanken, Vorstellungen, physiologischen Vorgängen, Körperhaltungen und Handlungen — eine These, die von der neueren Emotionsforschung gestützt wird. (vgl. Lutz 2000 und Zimbardo 1995, 442) Wenn ein Schauspieler sich zum Weinen bringt, weint er also am Ende über die vielfältigen kogni-physio-psycho-sensomotorischen Feedbackschlaufen 'wirklich'. Er hat sich intern einen kognitiven Anlaß zum Weinen geschaffen.
Zudem muß die Fähigkeit willkürlichen Weinens, wie gesagt, erlernt werden; wir werden nicht mit ihr geboren. Gerade 7% aller Frauen und 4,4% aller Männer gaben bei einer entsprechenden psychologischen Studie an, sie könnten sich ohne äußere Ursache zum Weinen bringen. Desweiteren ist die menschliche Mimik, wie schon Darwin feststellte, nicht konventionell; der Gesichtsausdruck wird in allen Kulturen gleich gedeutet (vgl. Zimbardo 1995, 452f.). Auch unsere Reaktion auf ein trauriges Weinen scheint einigermaßen universell. In fast jeder Situationen löst Weinen im Anderen positive Empathie und Hilfsbereitschaft aus. (vgl. Cornelius 1982, 3491-B f.)
Ich halte fest: Trauriges Weinen ist eindeutig, da es (1) kulturell universal, (2) direkt somatisch mit seinem inneren Zustand verbunden und daher nie gänzlich willkürlich, (3) körperlich, (4) die Sache selbst, statt nur Zeichen von etwas, ist. Trauriges Weinen bildet eine Einheit aus Anlaß, Empfindung, körperlichem Geschehen und äußerlichem Symptom. Wo immer ich in diesem Zusammenhang ansetze, am Ende führt er mich zum vollständigen Phänomen.
Aber all das löst sich auf und verschwindet, wenn wir den Rahmen der Reflektion darum ziehen. Nach einigen Wochen bemerkt der Erzähler plötzlich eine weitere Elendstouristin auf den Selbsthilfetreffen. "In diesem einen Augenblick spiegelt Marlas Lüge meine Lüge wider, und ich sehe nichts als Lügen. Inmitten all der Wahrheit hier. Alle klammern sich aneinander und trauen sich, ihre schlimmsten Ängste mitzuteilen, daß der Tod frontal auf sie zukommt und der Lauf einer Pistole tief in ihrem Schlund steckt" (Palahniuk 1999, 22f.). Die erlösenden Tränen versiegen, die Schlaflosigkeit kehrt zurück. "I cannot cry if there’s another faker present" (FIGHT CLUB). Der Anblick einer Simulantin weckt den Zweifel an der Echtheit des Leids der anderen und bringt die eigene Unaufrichtigkeit zu Bewußtsein. Wir können nicht weinen, wenn beständig eine kleine Stimme aus dem Hinterkopf mahnt: "Das ist nicht echt." Emphatisches Gefühl ist brüchig und rebellisch dazu. Es kann jederzeit vom Bewußtsein ausgehebelt werden; genauso gut kann es ungerührt bleiben, wenn wir es mit allen Mitteln des Bewußtseins zu verscheuchen suchen.
Der Erzähler stellt Marla zur Rede, doch die will keine einzige Selbsthilfegruppe abgeben: "Sie hätte sich nie träumen lassen, daß sie sich so wunderbar fühlen könnte. Sie fühle sich richtig lebendig. [...] Sie hatte kein wirkliches Gefühl für das Leben, weil es nichts gab, was sie ihm gegenüberstellen konnte. Ach, aber nun gab es Tod und Sterben, Verlust und Trauer. Weinen und Schaudern, Entsetzen und Reue. Nun, da sie weiß, wo wir alle hingehen, spürt Marla jeden Moment ihres Lebens" (Palahniuk 1999, 39f.). Weinen und Schaudern. Denn was ist der Kinogänger anderes als ein Elendstourist? Marla spiegelt nicht nur dem Erzähler, sondern in ihm zugleich uns als Kinozuschauern das eigene Bild wieder. Wenn wir mit Scarlett, mit Rose mitweinen, ergötzen wir uns an einem Schmerz, der nicht uns gehört. Das Mitleiden verschafft uns Horror und Terror, klarer, intensiver und eindeutiger, als wir sie in unserem eigenen Leben jemals spüren werden (meinen wir zumindest — und dann stirbt jemand). So schöne große Gefühle hätte man selbst mal gerne. So eindeutig. Nicht das damit verbundene Elend, nein — aber die Gefühle.
Durch dieses Stück kritische Theorie müssen wir jetzt kurz durch: Das Weinen im Kino verändert nichts, im Gegenteil. Die Flucht aus der zivilisatorischen Selbstkontrolle, die es darstellt, festigt die Zivilisation, weil sie zu ihren Bedingungen geschieht. Einerseits fühlen wir mit und der Schmerz der Anderen füllt unsere Leere. Das höhlt die Leere weiter aus; jedes Mal, wenn wir das hypertrophe Gefühl des Kinos konsumieren, ersetzen wir ein Stück reales Leben mit Fiktion und heben die Meßlatte ein wenig höher. Andererseits trennen wir — gute Ironiker, die wir sind — nach der Vorführung scharf in mitgefühlte Fiktion und eigenes Leben, damit genau dieser Effekt nicht einsetzt. Bevor das Leben uns enttäuscht, begeben wir uns selber vorsorglich in die Position des immer schon Enttäuschten. Wie soll dann aber Mitleiden jemals in Handeln übergehen? Die Gegenstimme kommt naturgemäß aus den Cultural Studies: Muß denn alles immer sozial relevant sein? Weinen im Kino ist Genuß. Schließlich fordert auch niemand vom Genuß des Eisessens soziale Relevanz ein.
Die Situation in der Selbsthilfegruppe entspricht der Situation im Kinosaal noch auf eine andere Weise. An beiden Orten ist öffentliches Weinen möglich und gesellschaftlich erlaubt. Laut der umfänglichen psychologischen Studie von Williams und Morris weinen wir am häufigsten allein, und am seltensten, wenn wir uns in der Öffentlichkeit unter fremden Menschen befinden. Die beiden Psychologen stellen die These auf, daß das Weinen in der Öffentlichkeit nicht hauptsächlich deshalb so selten geschehe, weil es sozial unerwünscht ist. So widersprechen ihre Ergebnisse auch der gängigen These, Männer unterdrückten ihre Tränen stärker als Frauen, weil es nicht ihrem gesellschaftlichen Geschlechterbild entspräche. Sondern wir weinen deswegen so selten öffentlich, weil es uns in eine (vielleicht unerwünschte) soziale Interaktion einspannt. (vgl. Williams/Morris 1996) Wenn wir vor einem Anderen weinen, provozieren wir in ihm eine Reaktion und müssen uns dann unsererseits mit seiner Reaktion auseinandersetzen, auf ihn Rücksicht nehmen, uns mühselig erklären usw.7
Eigentlich kreist Weinen aber um sich selbst. Der Fokus richtet sich von der Umwelt auf die eigenen Gefühle und die mit ihnen verbundenen Bilder; im Moment des Weinens können wir nicht normal handeln und reagieren, sind aus dem normalen Leben ausgehakt.
Das Kino bietet einen Ausweg. In der Dunkelheit und Fixierung der kollektiven Aufmerksamkeit auf die Leinwand bin ich allein gelassen. Ich befinde mich in einem Schonraum außerhalb des öffentlichen Lebens. Ich lasse meinen Körper in den Kinosessel sinken, die Gebärmutter des Vorführsaals umfängt mich. Für die nächsten zwei Stunden muß ich nichts tun, niemand wird mich ansprechen oder beobachten. Ich kann also die Kontrolle über mich und meine Gefühle aufgeben. Wenn das die spezifische Situation des Kinobesuchs ist, dann wird genau das auch eine entscheidende Motivation sein, sie aufzusuchen: Nämlich aus dem sozialen Gerüst der normierten Interaktion fliehen, die Selbstkontrolle aufgeben, die uns von der Intensität unserer Gefühle abschneidet.
Das Aufgeben der Selbstkontrolle wiederholt sich im Weinen selbst. Laut Williams und Morris lassen sich zwei Formen des Weinens unterscheiden. Einerseits gibt es das intensive, lang anhaltende und wesentlich nicht kontrollierbare Weinen, ausgelöst von starken emotionalen Erschütterungen wie dem Tod naher Verwandter. Daneben steht die leichtere, kürzere und einfacher zu unterdrückende Form des Weinens aus Sympathie, die Psychologen vor allem beim Betrachten trauriger Filme beobachtet und untersucht haben. (vgl. Williams/Morris 1996) Wie bereits gesagt, können wir nicht willkürlich anfangen zu weinen. Zumindest bei der zweiten, leichteren Form des Weinens können wir jedoch ziemlich zuverlässig steuern, ob wir aus diesem Anlaß in Tränen ausbrechen oder nicht. 79,2% von den 442 Befragten der Studie gaben an, sie könnten das Weinen willentlich stoppen bzw. unterdrücken. (vgl. ebd.)
All das führt auf das eine Wort, das stellvertretend für die ganze Kultur des heutigen 'sanften', 'ganzheitlichen' psychologischen Menschen steht, wie wir ihm in esoterischen Ratgebern, Selbstverwirklichungseminaren oder eben Selbsthilfegruppen begegnen. Das Wort heißt "Loslassen". Im Weinen geben wir die Kontrolle über uns selbst auf. Und im Kino suchen wir bewußt Anlässe zum Weinen auf, da uns der Raum des Kinos genau diese Passivität erlaubt. Darin liegt immer das Paradox, daß wir die Passivität aktiv herstellen. Weinen und Kino gleichen sich fundamental im kontrollierten Kontrollverlust. Schon Plessner wies auf dieses Paradox als Unterschied des Weinens zum Lachen hin: "Der Mensch verfällt ihnen, er fällt — ins Lachen, er läßt sich fallen — ins Weinen". (Plessner 1950, 40)
Wie auch immer, kurz nach dieser Vertreibung aus dem Paradies der Selbsthilfegruppen sprengt ein Unbekannter die Wohnung des Erzählers von FIGHT CLUB in die Luft. Kurze Zeit darauf erscheint die Lösung für Schlaflosigkeit wie Heimatlosigkeit in Gestalt der Flugzeugbekanntschaft Tyler Durden. Er wird den Erzähler bei sich wohnen lassen, unter einer Bedingung: "I want you to hit me as hard as you can". Irritiert, übermüdet, betrunken willigt der ein. Er schlägt zu, wird geschlagen — und erlebt einen Moment der Epiphanie: "It really hurts. Hit me again". Von da an Treffen sich der Erzähler und Durden regelmäßig zu mutwilligen Schlägereien. Zufällige Passanten schlagen bald mit ein. Nach kurzer Zeit gründen sie den ersten Fight Club.
Sicher ist es unmoralisch und absurd, wenn man aufeinander einhaut, aber man tut etwas, man spürt etwas — was, das ist erst einmal nebensächlich. Kein Gerede. "Fight Club wasn't about 'winning or losing. It wasn't about words". Alles, was wir wollen, ist nur ein einziges eindeutiges Gefühl, ein unmißverständliches Zeichen. Und im Schmerz hat man das letzte, selbstidentische, feste und zweifellose Zeichen entdeckt: "Das tut weh!" Nur im körperlichen Schmerz findet das moderne Subjekt noch zu sich selbst. Zweimal erkennt der Erzähler in FIGHT CLUB voller Erstaunen sein eigenes Gesicht: Im Tränenabdruck auf dem T-Shirt von Bob, und im Blutabdruck auf dem Boden des Fight Club. Während das positive Gefühl immer noch von Zweifeln überschattet sein kann, das Leid der anderen dem Verdacht der Täuschung unterliegt: Schmerz ist Schmerz. Deshalb grinsen die Darsteller von MTV jackass permanent wie bescheuert. "Das muß doch wehtun!" Ja, das muß auch wehtun, sonst bringt es ja nichts. Skårderud schreibt: "Selbstverletzung kann eine Selbststimulierung sein, um dem Gefühl von Leere, Leblosigkeit und Abgeschnittensein zu entgehen. [...] Die Selbstverletzung benutzt das Hyperkonkrete und Überdeutliche als Mittel gegen Gefühllosigkeit und Undeutlichkeit. Eine Wunde, eine Brandverletzung oder fließendes Blut sind deutlicher Ausdruck eines inneren Zustandes. Es sind definierte, abgrenzbare und sichtbare Verletzungen, die einer inneren Verletzung, die schwerer zu definieren, abzugrenzen und zu sehen ist, einen Namen geben". (Skårderud 2000, 276, 280)
An diesem Punkt stoßen Film wie Roman an ihre Grenzen. Die Protagonisten fliehen aus der regulierten Ersatzwelt der Medien, aus jeder zivilisatorischen Ordnung in den körperlichen Schmerz. Der Schmerz ist, was er ist; der Film muß Repräsentation bleiben. FIGHT CLUB nutzt die üblichen Mittel der Ironie und Selbstreferenz, um aus Raum der Repräsentation auszubrechen. Tyler Durden arbeitet selber als anarchischer Filmvorführer, der Einzelbilder aus Pornos in Familienfilme einschmuggelt. Natürlich tauchen solche subliminalen Einzelbilder dann im Filmmaterial von FIGHT CLUB auf (zu sehen: Tyler Durden). Im Film brennt Durden dem Erzähler ein Loch in die Hand, um ihn "zum Nullpunkt" zu bringen, zur absoluten Konfrontation mit der Realität: "Stay with the pain! No self deception! Stop it! This is your pain! This is your burning hand! It's right here! Shut up!". Und in einer Parabase kurz zuvor spricht der Erzähler den Zuschauer direkt auf die sogenannten "Brandlöcher" im Film an, die dem Vorführer das Signal zum Rollenwechsel geben. Sofort erscheint ein solches Brandloch im Filmmaterial, und Durden weist mit dem Finger darauf. Das Brandloch im Film und in der Hand: "That's the clue for a change-over". Wenige Zeit später knattert der Filmstreifen künstlich aus der Spule, während Durden eine Ansprache hält. Der Raum der Repräsentation vibriert unter seiner Energie, er versucht die Trennwand einzureißen, was ihm letztlich natürlich nicht gelingen kann.
Ironie und Selbstreferenz sind unsere gängigen Strategien geworden, um mit Zuständen der Uneindeutigkeit, Beliebigkeit, Leere, Kontingenz und Vorläufigkeit umzugehen. Wir untergraben den eigenen Standpunkt, weil wir für nichts mehr mit Ernst einstehen können. Was wir auch sagen, wurde schon gesagt und wird an anderen Orten zu anderen Zeiten anders gesagt werden. Aber Ironie nährt selbst die Leere, deren Schmerz sie lindert. Sie dämpft unser Empfinden, "denn die ironische Distanz gibt uns die Möglichkeit, uns über das Ganze zu erheben. [...] Das Ironische bedient sich einer ent-affektierten Sprache. Die gleiche Distanz birgt aber die Gefahr in sich, daß uns die Erfahrung von Bedeutung abhanden kommt, denn wenn alles gleich bedeutend wird, besteht die Gefahr, daß es gleichgültig wird". (Skårderud 2000: 22) Anders gesagt: Wenn Uneindeutigkeit das Problem ist, wird noch mehr uneindeutiges Sprechen kaum die Lösung bringen. Ironie ist cool. Aber hinter der Sonnenbrille driften wir langsam in die Verzweiflung.
Genau an diesem Punkt setzt Paul Thomas Andersons Film MAGNOLIA ein. MAGNOLIA ist alles andere als cool. Anderson wagt das Pathos, fällt aber nicht in die Kitschglut der Sonnenuntergänge und brennenden Landsitze zurück. Der Film verknüpft die Lebensgeschichten von zwölf Figuren in Los Angeles und führt dabei jede an einen Punkt persönlicher Katharsis. Alle zwölf leiden: Da ist der Todkranke auf dem Sterbebett, der sein Leben bereut und sich mit seinem Sohn aussöhnen will. Da ist seine Frau, die ihn betrog, wahnsinnig vor Schuldgefühlen. Da ist sein Sohn, der seine Vergangenheit in coolem Machismo begraben hatte und jetzt mit ihr konfrontiert wird. Der Pfleger, der all dies mitleidet. Das von seinen Eltern betrogene ehemalige Wunderkind, das sein Leben verfahren hat. Da ist das gedemütigte Kind, das um die Liebe des Vaters kämpft, sein Vater, da ist der krebskranke Quizshow-Moderator, dessen Lebenslügen zusammenbrechen, seine betrogene Ehefrau, die von ihm mißbrauchte Tochter, drogenabhängig, voller Zorn und scheinbar zu keiner Beziehung in der Lage, der einsame Polizist, das schwarze Straßenkind, ... Drängt man die drei Stunden des Films in ein paar Zeilen, wirkt das übermäßig, vielleicht kitschig, auf jeden Fall pathetisch im ursprünglichen Wortsinne.
Junge und alte Figuren spiegeln sich vielfach. Die einen fliehen vor den Fehlern und Verletzungen ihrer Vergangenheit, in die die anderen gerade zu geraten drohen. Alle Figuren befinden sich in absolut ernsten Situationen: die Schutzlosigkeit eines Beziehungsversuchs, die öffentliche Demütigung und das Drama des begabten Kindes, Schuld, Aussöhnung, das Scheitern des eigenen Lebens, die Reue darüber, die verzweifelte Suche nach Liebe, der Tod, der Tod. Und sie alle weinen. In keinem Kinofilm der letzten Jahre ist so viel und so unterschiedslos zwischen den Geschlechtern geweint worden. Sogar vor der Leinwand und dort im Kreis jener durch und durch reflexiven Intelligenzja, der eigentlich nachgesagt wird, sie sei gegen derartige Irrealitäten immun.
Dabei kreisen die Ereignisse um zwei Zentren, das Sterbebett des todkranken Earl Partridge, und das erste Date zwischen Claudia Gator, der drogenabhängigen Tochter des Quizshowmoderators, und dem Polizisten Jim Kurring. Tod und Liebe (man muß aufpassen, nicht in alte philologische Stereotype zu fallen) bilden die Konstanten, die das fiktive Geschehen letztlich an die Wirklichkeit rückbinden. Wie in FIGHT CLUB ist die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit der "Nullpunkt", an dem man die Oberfläche des modernen Konsumlebens durchstößt. Im Angesicht des Todes fallen alle Lüge und Ironie ab. Der eigene Standpunkt ist so eindeutig wie nur möglich: Man stirbt. Aus dieser Klarheit heraus läßt sich geradeheraus sprechen: "Wenn du ein Mädchen hast, bleib ihr treu und tu mit ihr all die schönen Dinge, die man tut. Denn die Geschichten sind alle wahr, hörst du, sie sind wirklich wahr." (MAGNOLIA)
Auf den ersten Blick fällt MAGNOLIA damit in allem hinter die kritische Reflexion von FIGHT CLUB zurück. Der Film setzt den klassischen psychotherapeutischen Diskurs in Szene: Die verdrängten Verletzungen der Kindheit lösen sich in Momenten tränenreicher Katharsis. Die Tränen beglaubigen die Echtheit und den Ernst der Situation (desgleichen das notorische Fluchen, dessen Frequenz sogar die einschlägiger Gangsterfilme noch übertrifft. Kein Satz, der nicht noch ein kleines spontan-authentisches "Fuck" vertrüge8). Aber Anderson führt das vormoderne Pathos nicht unreflektiert fort, sondern setzt es bewußt im Kontext der Ironie. Das Pathos antwortet auf die offenkundige Unausweichlichkeit der Ironie im Zeitalter der Simulakren:
[Interviewer:] 'It's something that happens'; 'But it did happen' — these are both refrains throughout the film.
[Anderson:] There it is, right there, the simplest possible expression of a truth. 'It did happen.' I'm a film geek; I was raised on movies. And there come these times in life where you just get to a spot when you feel like movies are betraying you. Where you’re right in the middle of true, painful life. Like, say, somebody could be sitting in a room somewhere, watching their father die of cancer, and all of a sudden it’s like, no this isn't really happening, this is something I saw in Terms Of Endearment. You're at this moment where movies are betraying you, and you resent movies for maybe taking away from the painful truth of what's happening to you — but that's exactly why those moments show up in movies. Those things 'do happen'.
And I also wanted to get those moments in life that don't get covered in movies. Like, you're going to a funeral and all the parts of it that you've seen in movies are there — the mournfulness, the sadness — but then there come those moments that are foreign to you because, in a way, they haven't been shown to you in a movie before. The part where, say, you're going to the funeral and you're faced with the little realities of things like, where am I going to park my car?
(Stephens/Anderson 2002)
Dabei besitzt auch MAGNOLIA durchaus selbstreferentielle Einschübe. Den ganzen Film durchzieht ein verstecktes Zeichenspiel mit den Zahlen 8 und 2, die auf Exodus 8:2 verweisen und so den kathartischen Froschregen am Ende des Filmes vorbereiten.9 In einer Szene versucht der Pfleger des todkranken Earl Partridge, über eine Hotline an die Telefonnummer seines Sohnes zu gelangen:
PHIL: I know this all seems silly. I know that maybe I sound ridiculous, like maybe this is the scene of the movie where the guy is trying to get ahold of the long-lost son, but this is that scene. Y'know? I think they have those scenes in movies because they're true, because they really happen. And you gotta believe me: This is really happening. I mean, I can give you my phone number and you can call me back if you wanna check with whoever you can check this with, but don't leave me hanging on this -- please -- please. See: See: See this is the scene of the movie where you help me out --
(Anderson 2000)
Der Film bleibt nicht dabei stehen, seine eigene Gemachtheit bewußt und verdächtig zu machen. Er sagt: Ich weiß, daß ich 'nur ein Film' bin, und ich kann das nicht ignorieren; aber ich versuche trotzdem, etwas über die Wirklichkeit zu sagen. Diese Dinge passieren nun einmal — sie sind wirklich wahr, trotz aller Inszenierung, trotz aller Ironie, obwohl wir sie tausendmal im Film gesehen haben. Trotz allem Versteckspiel hat das Leben kein bißchen an seiner Schwere verloren, wir haben uns nur kurzzeitig darüber hinwegtäuschen lassen. MAGNOLIA versucht so etwas wie einen neuen Gesellschaftsvertrag der Aufrichtigkeit und des Ernstes über alle bewußte Vorläufigkeit hinweg.
Explizit wird das in der zweiten Kernszene, dem ersten Date zwischen Jim Kurring und Claudia Gator. Vielleicht die größte Kunst besteht heute darin, einem Menschen authentisch zu sagen: "Ich liebe Dich." Umberto Eco formuliert das so: "Die postmoderne Haltung erscheint mir wie die eines Mannes, der eine kluge und sehr belesene Frau liebt und daher weiß, daß er ihr nicht sagen kann: 'Ich liebe dich inniglich', weil er weiß, daß genau diese Worte schon, sagen wir, von Liala geschrieben worden sind. Es gibt jedoch eine Lösung. Er kann ihr sagen: 'Wie jetzt Liala sagen würde: Ich liebe dich inniglich." (Eco 1987: 78f) Und genau diese Lösung befriedigt nicht mehr, sie ist ein ermüdendes Spiel geworden (Jim Kurring zu Anfang des Films: "I‘m through playing games"). Die Lösung von MAGNOLIA sieht so aus:
CLAUDIA: Did you ever go out with someone and just....lie....question after question, maybe you're trying to make yourself look cool or better than you are or whatever, or smarter or cooler and you just -- not really lie, but maybe you just don't say everything --
JIM KURRING: Well, that's a natural thing, two people go out on a date, something. They want to impress people, the other person...or they're scared maybe what they say will make the other person not like them –
[...]
CLAUDIA: You wanna make a deal with me?
JIM KURRING: ok.
CLAUDIA: What I just said...y'know, people afraid to say things....no guts to say the things that they...that are real or something...
JIM KURRING: ...yeah...
CLAUDIA: To not do that. To not do that that we've maybe done -- before –
JIM KURRING: Let's make a deal.
CLAUDIA: Ok. I'll tell you everything and you tell me everything and maybe we can get through all the piss and shit and lies that kill other people...
[...]
[CAMERA tracks with Claudia as she walks back to the table...she comes up from behind Jim Kurring and leans in quick...KISSES HIM ON THE CHEEK and then quickly sits down across from him]
CLAUDIA: I wanted to do that.
[Jim Kurring smiles, shaken a bit.]
JIM KURRING: Well.
CLAUDIA: That felt good to do...to do what I wanted to do.
JIM KURRING: Yeah.
(Anderson 2002)
Wer etwas ernst meint, wer etwas ernst nimmt — sei es das Wort eines Anderen oder ein Film oder auch nur das eigene Leben —, begibt sich in reale Gefahr. Man könnte verletzen oder verletzt werden. Man könnte verändert werden. Man könnte sogar etwas fühlen.
- 1Baudelaire, Charles (1998): Die Blumen des Bösen. Le Fleurs du Mal. Vollst. zweispr. Ausg. A. d. Frz. übertr., hg. u. komm. v. Friedhelm Kemp. 2. Aufl., München: dtv, 10f.
- 2Aristoteles führte den Begriff der Katharsis — hier mit "Reinigung" übersetzt — nicht weiter aus, so daß er durch die Geschichte verschiedenste Deutungen erfuhr. "Den überschüssigen Müll loswerden" ist eine recht einfache Variante, und nicht einmal wirklich treffend. Katharsis kann auch als Läuterung verstanden werden, ähnlich einem Destilliergerät, das ein trüb gewordenes Gemisch wieder in seine einzelnen Substanzen zerfällt — ich tendiere zu dieser Interpretation. Eine andere Deutungsvariante besagt, daß die Gefühle im Theater/Kino mit kulturell angemessenen Anlässen verknüpft bzw. die bestehenden Verbindungen verstärkt werden. Das Theater/Kino diene also dazu, unseren Gefühlshaushalt auf gesellschaftlich wünschenswerte Weise zu konditionieren, eine Art Empathie-Workout.
- 3Überhaupt macht diese "Natural and Cultural History of Tears" (englischer Untertitel) derzeit wohl den besten Rundumschlag zu allen Fragen um die Träne im Kino. Lutz behandelt Physiologie, Psychologie, Kunst- und Kulturgeschichte sowie Kultur- und Geschlechterdifferenz des Weinens.
- 4Wenngleich Freud sich später von dieser Ansicht löste und meinte, nicht die Gefühle, die Triebe seien das Aufgestaute. Das hydraulische Bild freilich blieb.
- 5z.B. Kottler, Jeffrey A. (1997): Die Sprache der Tränen: Warum wir weinen. München: Diana. Vgl. Lutz 2000: 133ff.
- 6Elias nennt diesen Prozeß den "gesellschaftliche[n] Zwang zum Selbstzwang" (Elias 1994, 2, 312), Foucault faßt ihn mit dem Begriff Subjektivierung, "eine Machtform, die aus Individuen Subjekte macht" (Foucault, 246). Die zugrundeliegende Denkfigur findet sich bereits in Freuds Das Unbehagen in der Kultur, wenn er dort die Genese des Gewissens beschreibt: "Der (uns von außen auferlegte) Triebverzicht schafft das Gewissen, das dann weiteren Triebverzicht fordert" (Freud 1994, 91).
- 7Ähnlich auch Cornelius 1982.
- 8Ein Wahnsinniger auf der Internet Movie Database will 192 "fucks" gezählt haben (man schüttelt ungläubig schnaufend den Kopf, nickt dann doch wieder anerkennend; man selber hat nur die Texterkennung über das Drehbuch laufen lassen. Ergebnis: 218). Eine ähnliche Beglaubigungsfunktion hat das Fluchen im Rap, im HipHop oder Punk. "Explicit Lyrics" sagt im Grunde: Das hier ist ungeschnitten, roh, echt. Es geht hier um was, da schert man sich nicht mehr um die Form.
- 92. Buch Mose, 8, 1-2: "(1) Darnach sprach der Herr zu Mose: Gehe zum Pharao und sage zu ihm: So spricht der Herr: Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene! (2) Wenn du dich aber weigerst, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen plagen." Unter allen Möglichkeiten der Postmoderne wählt Anderson die unwahrscheinlichste, ja anstößigste. Der Vertrag des Ernstes geht über die zwischenmenschliche Ebene hinaus. Er erfaßt nicht nur die Sprache und erneuert den Vertrag zwischen Wort und Welt. Er erstreckt sich bis zu SEINER realen Gegenwart in der Geschichte.
Den ganzen Film umspannt eine Rahmenerzählung aus drei unglaublichen Geschichten. 1911 werden drei Männer wegen Mordes an Sir Edmund Berry Godfrey aus dem Londoner Stadtteil Greenberry Hill verurteilt. Ihre Namen: Green, Berry, Hill. Ein Seetaucher wird von einem Löschflugzeug mit Wasser aufgenommen und über einem Waldbrand abgelassen. Und ein Selbstmörder hätte den Sprung in den Tod überlebt, hätte sich nicht just in dem Moment ein Schuß aus dem von ihm selbst zuvor geladenen Gewehr in der Hand seiner Eltern gelöst, als er an ihrem Fenster vorbeiflog. All dies scheinen urbane Mythen, absurde Zufälle. Aber der Erzähler beharrt darauf, daß sie Sinn machen im altmodischsten Sinne. Um diesen Sinn zu erweisen, erzählt er die dreistündige Geschichte von zwölf Menschen, deren Leben durch einen Froschregen über der Magnolia Avenue, San Fernando, Kalifornien auf die rechte Bahn gebracht werden. "...and it is in the humble opinion of this narrator that this is not just 'Something That Happened.' This cannot be 'One of those things...' This, please, cannot be that. And for what I would like to say, I can't. This Was Not Just A Matter Of Chance" (Anderson 1999). Der Froschregen wird von zahllosen Anspielungen vorbereitet, neben dem 8-2-Zahlenspiel durch regelmäßige Verweise auf Charles Fort (1874-1932). Diese Ikone der 'Gegenwissenschaften' sammelte 27 Jahre lang in den Archiven der Londoner und New Yorker Bibliotheken Presseberichte aus Tageszeitungen und wissenschaftlichen Magazinen über unerklärliche Phänomene. Der Mord in Greenberry Hill ist ein wörtliches Zitat aus Forts letztem Buch Wilde Talente (Fort 1998, 8), das in einer Filmszene auf einem Büchertisch zu sehen ist, neben anderen Büchern über urbane Mythen, Wunderkinder und Wetterphänomene. Forts Buch der Verdammten (1995, 58, 101f., 234, 389) listet Seite um Seite Berichte über Niederschläge von skurrilen Gegenständen, wie Blut, Kohle, Eisen, Steine, usw., darunter wieder und wieder: Frösche.
Wer die Zeichen zu lesen weiß, erkennt nach drei Stunden das Ungeheure: "When the sunshine don‘t work, the good lord bring the rain in", wie es in MAGNOLIA heißt. Was im Vertrag des zwischenmenschlichen Vertrauens, der Vertrauung von Wort und Welt erneuert wird, ist nichts als der Bund mit Gott. Der Froschregen ist so unbezweifelbar und jenseits jeder zivilisatorischen Ordnung, jenseits jedes nur rhetorischen Disputes, das spricht für Gott, das spricht gegen ihn: es ist wirklich passiert. Einen derartigen Ausweg aus der Postmoderne hat sonst nur noch George Steiner versucht. In seiner Erwiderung auf die Dekonstruktion, Von realer Gegenwart (1990, 13f.), heißt es: "Die These lautet, [...] daß jede logisch stimmige Erklärung des Vermögens der menschlichen Sprache, Sinn und Gefühl zu vermitteln, letztlich auf der Annahme einer Gegenwart Gottes beruhen muß [...], daß die Voraussetzung, der Begriff Sinn habe einen Sinn, — also darauf zu setzen, daß Verstehen und Erwiderung möglich sind, wenn eine menschliche Stimme sich an eine andere richtet, wenn wir in Kunst oder Musik uns Text oder Werk gegenübersehen, und das heißt, wenn wir dem Anderen in seinem Zustand der Freiheit begegnen — ein Setzen auf Transzendenz ist."
Anderson, Paul Thomas (2002): Magnolia Shooting Script. Auf: www.lontano.org/FMA, Stand 25.2.2002.
Aristoteles (1994): Poetik. Griechisch/Deutsch. Übers. u. hg. v. Manfred Fuhrmann. Stuttgart: Reclam.
Baudelaire, Charles (1998): Die Blumen des Bösen. Le Fleurs du Mal. Vollst. zweispr. Ausg. A. d. Frz. übertr., hg. u. komm. v. Friedhelm Kemp. 2. Aufl., München: dtv.
Cornelius, Randolph Ray (1982): Weeping as social interaction: The interpersonal logic of the moist eye. In: Dissertation Abstracts International B 42,8, Februar 1982, S. 3491-B f.
Elias, Norbert (1994): Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 2 Bde. 18. Aufl., Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Fort, Charles (1995): Das Buch der Verdammten. Frankfurt a.M.: Zweitausendeins.
Fort, Charles (1998): Wilde Talente. Frankfurt a.M.: Zweitausendeins.
Foucault, Michel (1994): Das Subjekt und die Macht. In: Dreyfus, Hubert L./Paul Rabinow: Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Weinheim: Beltz-Athenaeum.
Freud, Sigmund (1994): Das Unbehagen in der Kultur. Und andere kulturtheoretische Schriften. Einl. v. Alfred Lorenzer u. Bernard Görlich. Frankfurt a.M.: Fischer.
Frey, William H. (1985): Crying. The Mystery of Tears. Minneapolis: Winston Press.
Giddens, Anthony (2001): Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. 9th Reprint, Cambridge: Polity Press.
Huysmans, Joris-Karl (1992): Gegen den Strich. Übers. u. hg. v. Walter Münz u. Myriam Münz. Stuttgart: Reclam.
Kottler, Jeffrey A. (1997): Die Sprache der Tränen: Warum wir weinen. München: Diana.
Lutz, Tom (2000): Tränen vergießen. Über die Kunst zu weinen. Hamburg/Wien: Europa Verlag.
Palahniuk, Chuck (1999): Fight Club. München: Knaur.
Plessner, Helmuth (1950): Lachen und Weinen. Eine Untersuchung nach den Grenzen menschlichen Verhaltens. 2. Aufl., München: Leo Lehnen.
Sennett, Richard (2000): Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin: Siedler.
Skårderud, Finn (2000): Unruhe. Eine Reise in das Selbst. Hamburg: Rogner & Bernhard.
Steiner, George (1990): Von realer Gegenwart. Hat unser Sprechen Inhalt? München/Wien: Hanser.
Stephens, Chuck/Paul Thomas Anderson (2002): Magnolia Shooting Script Interview with PTA. Auf: www.ptanderson.com/articlesandinterviews/magbook.htm, Stand 25.4.2002.
Williams, D.G./Gabrielle H. Morris (1996): Crying, weeping or tearfulness in British and Israeli adults. In: British Journal of Psychology 87(3), August 1996, S. 479-506.
Zimbardo, Philip G. (1995): Psychologie. 6. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York: Springer.
Eco, Umberto (1987): Nachschrift zum Namen der Rose. 8. Auflage, München: dtv.