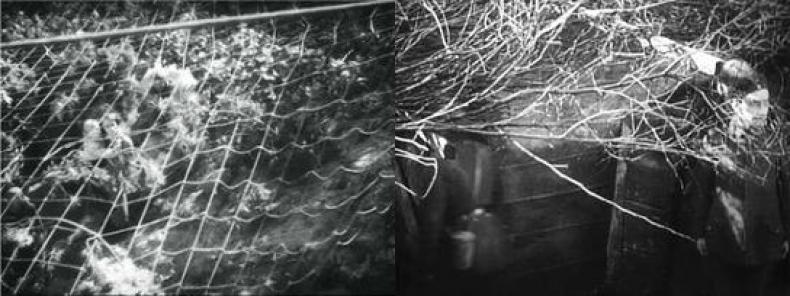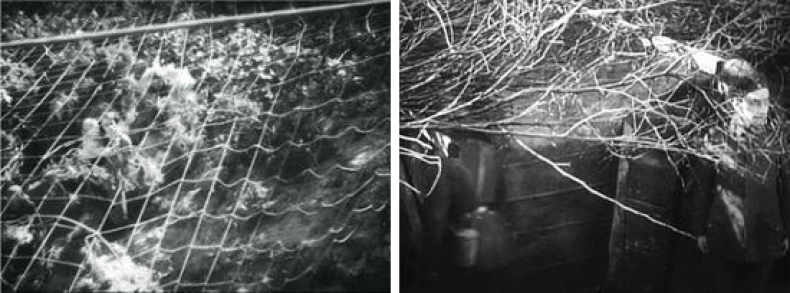Komplexität des Sinnlichen
Komplexität des Sinnlichen
Zum Verhältnis von „Audio History“ und Bildraumanalyse
In Publikationen, die sich explizit mit dem Ton im Film1 beschäftigen, wird oft und zurecht darauf hingewiesen, dass dieser in thematisch nicht auf den ‚Sound‘, d.h. auf Töne, Musik, Sprache fokussierten Analysen, trotz aller theoretischen Beteuerungen seiner Eigenständigkeit 2, ein marginales Dasein führe. Man kann als historischen Grund dafür die Abwesenheit eines ähnlich ausdifferenzierten Kategorisierungsvokabulars nennen, wie es für den visuellen Bereich existiert. Aber spätestens mit den Arbeiten Michel Chions sowie der an Produktionsparametern orientierten Taxonomie Barbara Flückigers, die zugleich die erkenntnistheoretischen Aporien der Filmtheorie in Bezug auf auditive Parameter herausarbeitet, kann man eigentlich nicht mehr vom Fehlen einer Grundlagenforschung sprechen. Umso dringlicher stellt sich die Frage, wieso analytisch davon eher weniger zu bemerken ist. Ich will im Folgenden diesbezüglich einige Vermutungen anstellen und diese dann anhand einer analytischen Skizze explizieren.
Was eigentlich fehlt, so meine These, ist die stärkere Beachtung eines Vokabulars für die Wechselwirkungen und das Ineinandergreifen von Ton und Bild in ihrer historischen Wandelbarkeit, wie es die Bildraumanalyse liefert.3 Denn m.E. ergibt sich die Historizität des Filmischen insbesondere aus dem permanenten, dynamischen Wandel einer spezifischen Spannung zwischen dem Auditiven und dem Visuellen. Gerade die Spannung oder die Schnittstelle zwischen Ton und Bild nämlich scheint mir Probleme aufzuwerfen, die das gängigste filmanalytische Modell, das sich auf die Arbeit der sog. Wisconsin-Schule4 stützt, schwer darstellen kann, handelt es sich doch um Dimensionen, die mit Erzählmounddellen nur teilweise zu fassen sind. Denn der Wisconsin-Schule sind alle Formen audiovisueller Konstruktion Parameter einer ihnen übergeordneten Funktion: des filmischen Erzählens, das sich nach den Prinzipien und erkenntnistheoretischen Voraussetzungen menschlicher Alltagswahrnehmung realisiert.
Aber muss filmische Bewegung, die nicht repräsentierte Bewegung ist, d.h. Montage, Kadrage, Rekadrierung etc., muss also der filmische Bildraum notwendig Funktion des Erzähl- oder Handlungsraums sein? Generieren audiovisuelle Konstruktionen nicht auch ganz eigene Formen ästhetischer Erfahrung, eigene Zeit- und Raumverhältnisse, die eigenen Gesetzen gehorchen? Fehlt diese letzte Dimension, führt das in Bezug auf das Verständnis von Ton und Bild dazu, dass in der Regel Tonstrukturen als Unterstützung und Verstärkung visueller Erzählstrategien betrachtet werden, oder aber – das wäre dann die Ausnahme von der Regel, die diese bestätigt – auditive Strukturen visuelle Erzählformen konterkarieren. Dass der Ton in dieser Gemengelage der Analyse immer dann entgleitet, wenn er sich nicht am visuellen Erzählmuster orientiert – welches, wie im Reiz-Reaktions-Schema, zeitlich und räumlich unmittelbar verknüpfte Töne und Bilder meint –, macht verständlich, dass Sound nur wenig beachtet werden ‚kann‘: Er fällt, im besten Falle, als Ergänzung des Visuellen nicht weiter ins Gewicht oder als Abweichung aus dem Raster narrativer Funktion des Audiovisuellen heraus. Dass aber Sound über die Szene hinaus wirkt, in der er erklingt und mit einem Bildinhalt zum audiovisuellen Erzählen verknüpft wird, dass also Ton und Bild auch über chronologische Abfolgen und Handlungslogiken hinaus interagieren, dass sie also eine wahrnehmbare Form von Zeit- und Raumerfahrung selbst erst herstellen können, kommt so nicht in den Blick.
Balázs’ Karriere als vermeintlicher Vater der Marginalisierung des Tons
Wie dominant das beschriebene filmanalytische Denken der Wisconsin-Schule ist, lässt sich beispielhaft an der Rezeption klassischer Positionen zum Filmton aus der sog. „formgebenden“ (u.a. Arnheim, Balázs) und der sog. „realistischen“ Position (u.a. Kracauer, Bazin) der Filmtheorie beschreiben. Denn egal ob ästhetische Konstruktion oder Realitätsabbildung im Vordergrund stehen sollten, meist wurden sie als Regelpoetiken gelesen,5 die auf diese oder jene Weise die Möglichkeiten des Filmtons verkannten. In seiner Abhandlung Der Geist des Films von 1930 setzt Béla Balázs sich ausführlich mit der Bedeutung des aufkommenden Tonfilms auseinander. Anders als der frühe Rudolf Arnheim ([1928] 2004) sieht er darin nicht den Niedergang des Films, sondern den Beginn von etwas ganz Neuem. Balázs beginnt sein Kapitel zum Tonfilm mit der erwartbaren Katastrophenrhetorik; kein Wunder angesichts eines Autors, der 1924 mit Der sichtbare Mensch eine der einflussreichsten Poetiken des Stummfilms vorgelegt hatte: „Der stumme Film war auf dem Wege, eine psychologische Differenziertheit, eine Gestaltungskraft zu erreichen, die kaum je eine andere Kunst gehabt hat. Da brach die technische Erfindung des Tonfilms wie eine Katastrophe ein.“ (Balázs ([1930] 1984/2:150). Die „Katastrophe“ waren für Balázs m.E. die konkret realisierten Tonfilme selbst und ihr Verständnis einer Bild-/Tonkoppelung als Illusionswirkung, die sich auf eine schlichte Formel bringen ließ: Das Bild illustriert das Gesprochene, Musik und Geräusche untermalen das visuelle Geschehen.
Damit stand nicht weniger auf dem Spiel, als dass die Bemühungen um eine Theorie des Films als ‚Kunst‘, d.h. als eigenständige Poetik, eines Illusionseffekts wegen zunichte gemacht würden. Als Dialektiker sieht Balázs aber mit dem Ton nicht Niedergang und Ende des Films gekommen, vielmehr postuliert er, dass der (noch unrealisierte) Tonfilm künstlerisch etwas vollkommen Neues sei und nicht einfach Stummfilm plus Ton. Der Tonfilm werde sich als eigenständige, neue Kunst neben oder nach dem Stummfilm entwickeln. Balázs beschreibt mit großer Präzision die Möglichkeiten der Verbindung, Parallelität, Gegenläufigkeit oder Eigenständigkeit von Ton und Bild als Merkmale einer ‚neuen‘ Kunst, was im Rekurs auf ihn etwas später dann auch Arnheim ([1932] 1979) formuliert. Die Idee der filmischen Komposition, wie Balázs sie schon für Der sichtbare Mensch entwickelt hatte, in der Takt und Note sowohl im Moment ihres Erklingens wirken wie auch im Nachklingen, d.h. auf das Ganze des Films hin, und somit Rhythmen, Refrains, Wiederholungs- und Variationsstrukturen etc. generieren, wird so gesehen mit dem Sound um eine Komplexionsstufe reicher.
In der Verkürzung dieser komplexen frühen Position, die die kunsttheoretische Analyse mit der einer Poetik des Tonfilms verbindet, scheint mir der Schlüssel für das Problem der Marginalisierung des Sounds zu liegen: Denn in dem Maße, in dem die Kritiker des frühen Tonfilms historisch stärker präsent blieben als seine Befürworter, in dem Maße ist auch das Potential der Diskussion um die Eigenständigkeit des Tonfilms gegenüber dem Stummfilm verlorengegangen.6 Denn auch die andere große filmtheoretische Richtung, die „realistische“, hat ja durchaus, wie exemplarisch an Kracauers Theorie des Films feststellbar ist, sehr detailliert und ausdifferenziert die verschiedenen Erscheinungsformen des Tons und ihrer Kombinationsmöglichkeiten mit dem Bild dargestellt. Es ließen sich andere theoretische Positionen anführen, die diese Arbeit unter anderen Prämissen fortsetzen.7 Warum aber dominiert in den Analysen das Bild – oder der Ton, und zwar dann meist explizit und exklusiv?
Flückigers bahnbrechende Studie Sound Design macht neben der systematischen Missachtung des Tons in der Filmtheorie (ausgenommen die Arbeiten Chions seit den 1980er Jahren) seine historische Marginalisierung in der Soundproduktion für seine Geringschätzung verantwortlich. Dies habe sich erst im Zuge New Hollywoods verändert und infolgedessen zu ausdifferenzierten Berufsfeldern geführt, die auch erst ein ausdifferenziertes Vokabular hervorgebracht hätten, welches Flückiger dann für ihre eigene Analyse fruchtbar macht. Aber noch in Flückigers Studie ist Balázs der Kronzeuge einer systematischen Vernachlässigung des Tons, die epistemologisch darin begründet liege, dass dieser für Balázs schlicht Realität abbilde (Flückiger 2001:69). Dass Balázs damit eine ästhetische Erfahrungsdimension des Filmtons, seine Materialität beschreibt, kommt nicht in den Blick. Diese Verkürzung der Position Balázs' hängt m.E. damit zusammen, dass hier die Voraussetzung der Analyse jene anfangs beschriebene Unterordnung der audiovisuellen Formen unter das Primat der Narration beinhaltet. Genau diese Verengung vollziehen insbesondere die ausdifferenzierten Modelle von Balázs und Kracauer aber keineswegs.
„Audio History“
Was bedeutet das, nimmt man die Ausgangsfrage noch einmal hinzu, nämlich die Frage danach, ob und wie sich Ton und Geschichte aufeinander beziehen lassen? Diesen Fragen widmet sich auch die Historikern Alexa Geisthövel, indem sie die Probleme ihrer eigenen Zunft beim Umgang mit Ton beschreibt. Sie legt den Finger in die Wunde, wenn sie bemerkt, dass die Geschichtswissenschaft mit Musik und Ton als Quellen immer dann so große Probleme habe, wenn diese funktionell nicht einzuordnen, semantisch nicht konkret fassbar seien; wenn es sich bei den auditiven Formen etwa nicht um Reden oder Hymnen handle. Es fehle dann zum einen das Vokabular, zum anderen seien, auch bei Kenntnissen von Notationssystemen, diese selbst immer noch als historisch relativ und damit selektiv aufzufassen (Geisthövel 2009:157ff.).
Implizit ist damit die Verengung einer auf narrative Parameter fokussierten Analyse, wie ich sie oben beschrieben habe, auch für die Geschichtswissenschaft formuliert. Dem Problem helfe man aber nicht ab, indem man „weiße Flecken“ tilge (Geisthövel 2009:166), d.h., indem man das eigene Fach einfach nur neu verknüpfe („Geschichte und...“). Geisthövel plädiert hingegen dafür, die Komplexität synästhetischer Formationen als leibliche Erfahrungen der Kombination auditiver und visueller Formen anzunehmen und systematisch deren Typologien in ihrem historischen Wandel zu erforschen.
Im Anschluss an diese Überlegungen scheint mir das Problem der Medienwissenschaft weniger mit der isolierten Aufwertung eines vernachlässigten Elements zu beheben zu sein (zumal die Sound Studies mit musikwissenschaftlicher Expertise dieses Feld zunehmend besetzen), sondern eher damit, sich noch stärker auf die ästhetische Komplexität des eigenen Gegenstands und seine Historizität einzulassen, und die eigene Methodik auf die Angemessenheit dieser Komplexität gegenüber zu prüfen. Aus medienwissenschaftlicher Perspektive heißt dies zum einen, die Geschichtlichkeit des Tons, sieht man von der Musik ab, als immer schon medial vermittelt zu bedenken; zum anderen gilt es die Möglichkeit zu prüfen, welche Dimensionen wissenschaftlicher Analyse hinzuzugewinnen sind, fokussiert man die audiovisuellen Konstruktionen nicht auf deren Funktion als ausschließliches Vehikel der Narration, sondern auf die verschiedenen Ebenen filmischer Erfahrung.
Historisches „Ohrenkino“
Die Möglichkeiten, die sich mit der Kategorie des Bildraums für die Filmanalyse ergeben, will ich im Folgenden an dem deutschen Spielfilm MORITURI (1948) verdeutlichen, der als erster ein KZ und dessen Funktion zeigt. Das Analysebeispiel ist dabei nicht willkürlich gewählt, sondern verbindet die angedeutete Problematik des Audiovisuellen mit ihrer historischen Herleitung und dem gewählten methodischen Ansatz. Denn thematisch bewege ich mich mit meinem Beispiel in einem Bereich, der wiederum paradigmatisch für einen sehr spezifischen und zugleich über lange Zeit sehr dominanten Umgang mit dem Filmton insbesondere in Deutschland steht: Nationalsozialismus (NS) und Zweiter Weltkrieg gehören zum einen auch deshalb zu den medial am meisten aufbereiteten historischen Ereignissen, weil sie aufgrund des Fortschritts der tontechnischen Entwicklung in den späten 1930er Jahren und ihrer erst im NS ökonomisch gelungenen Integration (Hans 2004, Koepnick 2002), erstmals die Illusion einer auditiven Realitätsabbildung evozieren konnten.
Einer der erfolgreichsten Filme des Dritten Reichs etwa, WUNSCHKONZERT (1940), stellt die mediale Inszenierung dieser technischen Möglichkeiten als auditive Vereinigung von Front und Heimatfront, als Volks(empfänger)gemeinschaft in den Mittelpunkt. Zum anderen verbindet sich mit der in den späten 1930er und 40er Jahren erreichten Perfektion der Tonaufzeichnung eine Auratisierung der Stimmen (des Bösen), die seitdem in unzähligen Kompilationen, Dokumentationen und Spielhandlungen, angefangen mit THE GREAT DICTATOR (1940) bis zuletzt noch in DER UNTERGANG (2004) wirksam ist: In diesem Film affiziert vor allem die stimmliche Anverwandlung Bruno Ganz‘ an Hitler den Zuschauer. NS und Nachkriegszeit können also als tontechnisch erstmals ausdifferenzierter, zentraler Bezugspunkt einer Medialität des Auditiven gelten (Bathrick 1999, Silberman 1995), die gerade in und vielleicht auch durch diese Kombination eine bis heute so durchschlagende Wirkkraft erzielte (wie sie schon Balázs postuliert hatte).
Dass wiederum die kritische Auseinandersetzung mit Imperialismus, Faschismus, Nationalsozialismus, Krieg, Holocaust und Völkermord nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere im revisionistischen Westdeutschland vor allem ideologiekritisch geprägt war, versteht sich historisch fast von selbst. Gerade die beschriebene Illusionierung und Auratisierung durch die audiovisuellen Inszenierungsformen des Films rief eine ideologiekritische Untersuchung auf, die sein Verständnis und seine Funktionsweise als wesentliches Propagandamittel des NS, als „Mobilisierung der Massen zur Immobilität“ (Witte 2004:126), versprach. Damit verbunden war auf der einen Seite die Skepsis gegenüber Filmkunstdiskussionen (nicht nur der Vorkriegszeit), hatten sich doch insbesondere die Avantgarden durch ihre Tuchfühlung mit den Diktaturen diskreditiert. Einer der Kronzeugen dieses Problems war Vertretern der Ideologiekritik Kracauers From Caligari to Hitler (1947), dessen komplexe methodische Position aber einer vereinfachten Lesart eines planen Abbildrealismus zum Opfer fiel (Ebert 1977).
Paradigmatisch wurde diese ‚vereinfachte Lesart‘ in der Auseinandersetzung mit dem NS-Propagandafilm: Analysen eines „Ohrenkinos“ hat Witte sie deshalb genannt, weil insbesondere anhand der Dialoge und Äußerungen in den Filmen propagandistische Absichten herausgearbeitet wurden (Witte 2004:117). Mit den Arbeiten Lowrys (1991), Rentschlers (1996), Schulte-Sasses (1996) und Wittes (1995) zum NS-Kino löst sich diese Fixierung auf die Semantik des Gesprochenen und dessen manifeste Propagandainhalte auf und macht einer komplexeren Analyse audiovisueller Affektpotentiale Platz; für das als marginal geltende (deshalb einer differenzierten Analyse nicht ‚würdige‘) und als ideologisch in der Kontinuität mit dem NS-Kino stehende deutsche Nachkriegskino gilt dieser Fokus (etwa Becker/Schöll 1995, Reichel 2004) aber mindestens noch bis zu Robert Shandleys Studie Rubble Films (2001).
Das zeigt sich exemplarisch an den Kritiken und Analysen zu meinem Referenzfilm MORITURI seit 1948. MORITURI erzählt von einer Handvoll Häftlingen, die dank der Hilfe eines Lagerarztes aus einem KZ in Polen fliehen und sich in ein Erdlager im Wald retten können, das von Naziverfolgten angelegt wurde, um dort versteckt den Krieg zu überleben. Der Film wurde bis heute insbesondere auf seiner verbalen Ebene analysiert und gilt deshalb als mehr oder weniger misslungen. Einige der zeitgenössischen Kritiken werfen MORITURI Textlastigkeit und hölzerne Dialoge vor: Das Drehbuch habe aus „Leitartikeln“ bestanden (Anonym 1948:22); die „glänzende filmische Wirkung des Bildes“ werde „unnötigerweise durch ein predigtartiges Plädoyer“ ersetzt (A.K. 1948).
Die erste deutsche Untersuchung zum Nachkriegsfilm, 1965 veröffentlicht von Peter Pleyer, schlägt in die gleiche Kerbe: „Die Menschen besitzen lediglich als Geschehensträger Bedeutung oder dienen als Sprachrohr für die Verkündung der von den Filmschöpfern beabsichtigten Tendenz“ (Pleyer 1965:65). In ihrem Buch über den Produzenten des Films, Artur Brauner, spricht Claudia Dillmann-Kühn in Bezug auf MORITURI u.a. vom „falschen Pathos“, von „dramaturgischen Mängeln“ und von „hohlen Dialogen“, lobt hingegen die Fotografie (Dillmann-Kühn 1980:24). Im Zusammenhang mit einer diachronen Analyse von Holocaust und Courtroom-Dramen, stellt Hanno Loewy den von den Waldlagerbewohnern abgehaltenen Prozess gegen einen gefangenen Wehrmachtssoldaten in den Vordergrund. Die wortreiche Darstellung beschreibt er als „recht pathetisch“ (Loewy 2003:136). Und schließlich urteilt Shandley in seinem Buch über den deutschen Trümmerfilm: „Morituris contribution to the construction of a collective memory of the Holocaust was mitigated by its somewhat flat ideological mission“ (Shandley 2001:94). Mit dieser ambivalenten Einschätzung bleibt für Shandley (und alle anderen zitierten Autoren) die Frage offen, was seinerzeit an dem vom Publikum völlig missachteten und z.T. bekämpften Film so anstößig war.
Opfer als Geschichtsagenten
Diese Anstößigkeit liegt m.E. in einer spezifischen Figureninszenierung begründet, deren Schlüssel nur über die auditive Konstruktion von MORITURI verständlich wird. Dabei erzeugt gerade die Tonebene eine Art historischer Vermittlung, die nicht nur semantische Bezüglichkeiten, sondern unmittelbar eine Erfahrung von Geschichtlichkeit evoziert, die Erfahrung eines Ineinanders der Zeitebenen. Deutlich werden soll nun, dass Soundpartikel in MORITURI eine paradigmatische Funktion erlangen, indem sie Ausgangspunkt einer Motivwanderung sind, die den ganzen Film umkonnotiert. Dabei kommt es nicht auf die Quantität der auditiven Elemente im Verhältnis zu den visuellen an und zwar weder in Bezug auf den Film noch in Bezug auf die Analyse; die Bildraumanalyse setzt nämlich auf ein musikalisches Prinzip der Zeitlichkeit bzw. der Dauer des Filmganzen, das von Rhythmus, Wiederholung, Variation und der Tatsache bestimmt ist, dass, wie in der Musik, in jeder einzelnen Note die ganze Komposition mit- und nachklingt und sich zugleich verändert. Diese Art von ‚Musikalität‘ lässt sich auch für die Filmlandschaft des frühen deutschen Nachkriegskinos insgesamt beschreiben, die schon unmittelbar nach dem Krieg die Formen und Topoi hervorbringt und erfahrbar macht, in denen in der Folgezeit über Krieg und Holocaust nachgedacht wird.8
MORITURI besteht aus zwei großen Teilen: Teil 1, der sich über das erste Drittel seiner etwa 80 Minuten erstreckt, zeigt das KZ und die mit diesem verbundene Flucht einiger der Häftlinge. Teil 2 inszeniert das Waldlager, in das sich die Flüchtigen retten. Im ersten Teil wird gleich zu Beginn eine akustische Spur gelegt, die der zweite Teil dann aufnimmt und visuell moduliert. MORITURI beginnt also mit einer horizontalen Kamerafahrt durch den Stacheldrahtzaun des KZ. Die Kamera fährt weiter auf eine Reihe Häftlinge zu. In drei Parallelfahrten, zunächst entlang der Oberkörper in gestreifter Häftlingskleidung, dann entlang der gleichförmig ausgerichteten Gesichter der Häftlinge und schließlich an ihren Füßen entlang vermisst sie diese. Zum Schluss der letzten Fahrt bleibt die Kamera abrupt am Ende der Reihe stehen und zeigt Wehrmachtsstiefel und einen deutschen Schäferhund. Weder in dieser noch in den folgenden Sequenzen sind die Gesichter der SS je zu sehen, einzig ihre Befehle sind zu hören. Die Selektion beginnt, die einzelnen Häftlinge rufen ihre Nummern aus, wenn sie zur Untersuchung antreten.
Die Selektion war der zeitgenössischen Öffentlichkeit zwar bekannt, bis dahin aber nie visualisiert worden. Gezeigt werden zudem die heute ikonischen Bilder von Stacheldraht, Häftlingsbaracken und Lagerwachturm, wie sie schon aus den Atrocity Pictures der Alliierten, etwa den TODESMÜHLEN (1945), seit 1945 geläufig waren. Diese in MORITURI ‚nachgestellten‘ dokumentarischen Bilder beglaubigen aber nicht etwa die fiktionale Form, im Gegenteil: Durch eine Verzeitlichung und Individualisierung der momenthaften, anonymen Dokumentaraufnahmen aus den Atrocity Pictures treten die Opfer der Konzentrationslager im Spielfilm als historische Subjekte auf und verschaffen dem Dokument, was es bis dahin nicht hatte, indem sie das Prinzip der Geschichte und der Bilder umkehren: Aus den „Ikonen der Vernichtung“, wie die Darstellungen der aus den KZ Befreiten genannt wurden (Brink 1998), wird die Erfahrung des Überlebens im Spielfilm. Diese Inszenierung des Überlebens geht einher mit der Individualisierung der Figuren und ihrer dadurch bedingten Gleichwertigkeit und Teilhabe. Die Delinquenten bekommen genau in dem Moment ein Gesicht, in dem sie bei der Selektion als arbeitsunfähig eingestuft und im Lagerbuch durchgestrichen werden. Denn ironischerweise sind es gerade die vom Arzt als untauglich Aussortierten, denen er zur Flucht verhilft. Ironischerweise deshalb, weil die Selektion eigentlich den buchstäblichen Gesichtsverlust bedeutet, die Auslöschung und Vernichtung aller Lebensspuren. Im Verlauf von MORITURI wird sie dagegen zum Ausgangspunkt dafür, dass die Figuren, statt Nummern zu sein, einen Namen, eine Zukunft und dadurch auch eine Vergangenheit bekommen.
Hören, was zu sehen sein wird
Am Schluss der ersten Sequenz marschieren die Häftlinge in Reih und Glied vom Appellplatz ab. Sie singen dabei auf Deutsch das Soldatenlied Die blauen Dragoner, sie reiten aus dem Ersten Weltkrieg.9 Gesang, Musik, Ton, Appell und Kamerabewegung betonen den militärischen Charakter der Szene. Die Tonspur der Sequenz bekommt hier aber auch noch eine paradigmatische Rolle für das Ganze des Films. Sie stellt die entscheidende Verbindung zwischen dem KZ- und dem Waldlager-Teil des Films her: Neben dem Soldatenlied hört man von Beginn an einen Trommelwirbel, der während der Selektion in einen Marschrhythmus übergeht. Diese musikalische Darstellung bricht dann abrupt ab, wird jedoch vom Stakkato des Selektierens, den Einteilungen des Lagerarztes („arbeitsfähig – nicht arbeitsfähig“), übernommen und stellt dadurch, zusätzlich zur Bedeutung des Gesagten, eine rhythmische Variation der kontinuierlichen akustischen Struktur der ersten Sequenz dar. Diese Struktur betont nicht nur den militärischen Charakter der Sequenz, sondern weist schon auf die eigentlich skandalöse Seite des Films hin, die sich aber erst in seinem Verlauf entfaltet: dass der militärische Duktus nicht nur Kennzeichen des KZ-Prinzips ist, sondern den Versuch markiert, den Opfern selbst von Beginn an eine kriegerische Haltung zu geben. Warum aber weist das Ineinanderübergehen der Rhythmen von Trommel, Selektion, Marschieren und des Lieds auf eine Wehrhaftigkeit der Opfer hin und warum werden daraus im Laufe des Films ‚Ikonen des Überlebens‘?
Der militärische Duktus des KZ bekommt in der beschriebenen Sequenz akustisch eine spezifische historische Signatur, die sich nicht allein aus dieser Sequenz erklären lässt, sondern nur aus ihrer Transformation, die der Film im Folgenden vornimmt: In der Anfangssequenz setzt die Szene damit, dass die Delinquenten das Soldatenlied von den „reitenden Dragonern“ singen müssen, dem militärischen Duktus zunächst einen zynischen Schlussakkord. In Bezug auf den Rest des Films ist der Gesang aber die akustisch-optische Signatur dafür, dass die Figuren sich hier nicht nur den Demütigungen ihrer Unterdrücker und Mörder beugen müssen, sondern dass sie sich, indem sie (im Gegensatz zur SS) als visuelle und akustische Figuren zusammen erscheinen, also singend zu sehen sind, als Subjekte der Geschichte sich diese auch aneignen können. Dieser Aneignung, der Entfaltung historischer Subjekte, widmet sich der Film dann von der Flucht aus dem KZ bis zur Aufnahme der Häftlinge durch die Versteckten im Waldlager. In der Darstellung dieses Waldlagers wird der beschriebene akustische Hinweis als Zeitklammer schließlich visuell ausbuchstabiert. Dieses Muster der Modulation zentraler Motive durch Wiederholung und Variation rhythmisiert den ganzen Film und beschreibt solcherart seine Musikalität. MORITURI verfolgt also zum einen das Prinzip aus den zu vernichtenden ‚Elementen‘ wieder menschliche Figuren zu machen. Im zweiten Teil, im Waldlager, werden die Naziverfolgten dann zu kämpfenden Figuren, die sich in ‚Ikonen des Überlebens‘ verwandeln – und zwar, indem der Film versucht, den ebenfalls seit 1945 bekannten ikonischen Darstellungen des Überlebens der ‚Täter‘, etwa in den Trümmern der Städte, wie sie in zahlreichen Dokumentar- und Spielfilmen vorzufinden sind, Darstellungen des Überlebens der Opfer entgegenzusetzen, die sich aus dem KZ-Kontext lösen.
Vom Ton zum Bild: „Tigersprung in die Vergangenheit“
Welche Modulation akustischer in visuelle Muster findet nun im Verhältnis von Teil 1 zu Teil 2 genau statt? Im zweiten Teil des Films wird häufig eine Aufsicht auf das Waldlager durch ein Tarnnetz hindurch gezeigt. Dieses Waldlager ist eine Vertiefung im Gelände. Oft sieht man auch den umgekehrten Blick der Waldlagerbewohner aus diesem hinaus. Es handelt sich um eine Untersicht durch das Tarnnetz; eine dieser Untersichten (Abb. 3) zeigt einen deutschen Soldaten, der das Lager entdeckt hat, dann gefangen genommen und später der Angeklagte in der immer wieder beschriebenen Gerichtsszene von MORITURI wird. Dann sind immer wieder gleichförmige Einzel- und Gruppenszenen im Lager zu sehen. Schon die häufige Wiederholung dieser Grundszenen hebt sie heraus. Aber aus welchem Zusammenhang sind sie bekannt?
M.E. stellen diese ‚Refrains‘ des zweiten Teils – also die den Rhythmus des Films bestimmenden quasi leitmotivischen Wiederholungen bestimmter Topoi, die im ersten Teil des Films von den ikonischen Darstellungen des KZ getragen werden – eine direkte Verbindung zu Bildern von Schützengräben her. D.h., die Bilder der Opfer des Naziregimes in ihrem Waldlager entsprechen dem, was von den Tätern und ihrer Front im Zweiten Weltkrieg berichtet wird und was sich insbesondere mit dem Stellungskrieg in und um Stalingrad verbindet. Von ‚diesem‘ Stellungskrieg gab es allerdings kaum Bilder, und die alliierte Zensur verbot die Herstellung von Kriegsfilmen. Doch es gab sehr wohl etablierte Bilder aus einem Krieg, der in Gänze als Stellungskrieg in die Geschichte einging, nämlich aus dem Ersten Weltkrieg. Das Leben und Sterben im Schützengraben war nicht nur in Dokumentarfilmen wie THE BATTLE OF THE SOMME (1916), sondern mehr noch in Spielfilmen der 1930er Jahre präsent, die große Publikumserfolge wurden: etwa in WESTFRONT 1918 (1930) oder in ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (1930). Wie MORITURI auf rein ikonographischer Ebene spielen diese Kriegsfilme zu einem großen Teil im tatsächlichen Schützengraben, zeigen das Leben und Sterben vor Ort – oft mit Blick aus dem Graben heraus, hin zum Feind, oder in den Graben hinein, auf das Alltagsleben im Bunker, das aus Essen, Schlafen und Warten besteht. Schaut man sich diese Filme an, sind die Ähnlichkeiten zu MORITURI deutlich erkennbar.
Ähnlich sind die Aufsichten auf das getarnte Lager durch eine Gitter- oder netzartige Struktur, sodass die Figuren nur schwer zu erkennen sind (Abb. 1&2). Man sieht dann eine Untersicht aus dem Lager auf den Feind, die Begrenzung des Grabens und den hellen Himmel, vor dem der Feind als Silhouette erscheint (Abb. 3&4).
Und schließlich ähnelt sich auch die Beengtheit des Bunkerlebens, die durch oft halbnahe, im Vordergrund mit Gegenständen verstellte Aufnahmen markiert ist (Abb. 5&6).
MORITURI beansprucht also nicht nur, den bekannten Bildern der Vernichtung eine Geschichte der Präsenz und Existenz zu geben, er tut dies auch noch in Bildformen, die ursprünglich anders konnotiert sind: die nämlich für das Leid und das ‚heroische‘ Opfer der Täter stehen, ohne dass sie, anders als die Trümmerbilder, auch tatsächlich im Nachkriegsdeutschland auftauchen dürfen, geschweige denn zu Topoi werden können. Der Film beansprucht also für die Opfer eine audiovisuelle Figuration des Überlebens, die sich aus dem ikonographischen Repertoire der Täter speist. Waren Trommel, Marschrhythmus und Soldatenlied, also die auditiven Parameter, im ersten Teil des Films Kennzeichen des KZ-Prinzips, d.h. der zynischen Vernichtungspolitik der Nazis, so tauchen diese auditiven Parameter als visuelle Modulationen (bei denen es sich gerade ‚nicht‘ um die „Ikonen der Vernichtung“ handelt) im zweiten Teil des Films wieder auf und zwar als Topoi, die sich die Opferfiguren von den Tätern aneignen.
Substanzlose Gemeinschaft
Aber bei dieser Umkonnotierung bleibt MORITURI nicht stehen. Denn wie schon die Selektion ironisch umgekehrt wird, so geschieht dies auch mit der Evokation des Schützengrabens: Das Waldlager in Teil 2 nimmt die militärische Komponente von Teil 1 auf, verwandelt sie aber in etwas Neues. Denn es handelt sich in MORITURI natürlich nicht um Soldaten an der Front, auch wenn sie akustisch so markiert sind. Ganz im Gegensatz zu der heroischen Darstellung der Soldaten im Schützengraben und deren Pathos der Kameradschaft, das auf die Homogenität des militärischen Gruppenkörpers zielt, inszeniert der Film im Waldlager eine ganz andere Gemeinschaft, die sich aus der beschriebenen Anordnung sowie der Neubesetzung der Topoi ergibt. Diese Gemeinschaft ist heterogen, kontingent und ohne Substanz, wie einerseits verschiedene Figurationen zeigen, die im zweiten Teil zwischen der Darstellung größerer und kleinerer Gruppen alternieren, zwischen Einzelnen und Paaren. Sie bilden hier ebenfalls eine refrainartige Struktur der Gemeinschaftsdarstellung aus. Zugleich wird der militärische Tonduktus aus dem ersten Teil, das Stakkato aus Ton, Musik und rhythmischem Sprechen Einzelner, nun in eine Vielfalt von unterschiedlichen Stimmen, Sprachen, Dialekten und Akzenten verwandelt, die ebenso zum Verstehen wie zum Missverstehen der Figuren untereinander beitragen. Als Ausdrucksqualität betrachtet, d.h. als Entfaltung heterogener Artikulationen, die gegen das KZ-Prinzip stehen, bekommt so noch die von der Kritik auf der narrativen Ebene monierte ‚Geschwätzigkeit‘ des Films im zweiten Teil eine wichtige kompositorische Funktion.
Diese Skizze einer Bildraumanalyse des Lebens der Figuren im Waldlager lässt sich mit Nancys Gemeinschaftsbegriff theoretisch fassen (vgl. Nancy 1988). Im Sinne seines Verständnisses von Gemeinschaft ist die Zeitform des Filmtitels – MORITURI ist das Partizip Futur aktiv des lateinischen Verbs mori: das sind „diejenigen, die sterben werden“ – hier nicht als Ausdruck für ein Schicksal zu verstehen, das die Gruppe überhöht, sondern als Ausdruck für diejenigen, die schlicht verbindet, dass sie sterben müssen, als gemeinsam geteilter Grund ihres Menschseins. Die Fiktionalisierung dokumentarischer Topoi und ihre Umkonnotierung dient in MORITURI also einer spezifischen Inszenierung von Gemeinschaft: Denn die raum-zeitlichen Modulationen des Films selbst – von der auditiven Allusion bis zur audiovisuellen Umkonnotierung – verwandeln einen Ort des radikalen Ausschließen (das KZ) in einen Ort gleichberechtigter Teilhabe (das Waldlager).
Erfahrung von Geschichtlichkeit
Für die deutsche Nachkriegskultur insgesamt beinhaltet die synchrone Bildung, die Um- und Neubesetzung akustischer und visueller Topoi einen Moment des Politischen als Struktur einer demokratischen Auseinandersetzung, wie sie beispielhaft in MORITURI als Dissens und als Spannung zwischen Bild- und Tonebene sinnlich erfahrbar wird: Gegeneinander stehen zunächst Dialog- und Bildebene in Teil 1 und 2. Während Teil 1, dem militärischen Drill entsprechend, wenige Dialoge und ikonische KZ-Bilder zugehören, wird in Teil 2 auf der narrativen Ebene viel und druckreif im Sinne der von den Alliierten propagierten Völkerverständigung gesprochen. Auf der Ebene des Bildraums hingegen nimmt der Film den beschriebenen Kampf um die Deutungshoheit auf. Dieser Kampf erzeugt eine Spannung, die sich zunächst in der Verbindung von militärischem Drill und der Verhöhnung der Opfer zeigt, d.h., dass die Gefangenen ihre eigene Vernichtung im Rhythmus der Täter orchestrieren müssen. Dabei sind sie gleichwohl, dem Verständnis der Selektion entgegengesetzt, nicht mehr wie die SS als akusmatische Figuren, sondern schon als (in Bezug auf den historischen Zusammenhang) entakusmatisierte Subjekte inszeniert. Über die semantische Funktion des Tons in den beschriebenen KZ-Szenen hinaus, hat die Toninszenierung aber auch eine strukturelle Bedeutung für den ‚ganzen‘ Film (wodurch sich Teil 1 und 2 ineinander spiegeln): Mit der musikalischen Anspielung auf den Ersten Weltkrieg und dem damit verbundenen militärischen Sound besetzt der Film alle Zuschreibungen um und verwandelt die Konnotationen von Täter und Opfer vollständig. Die Opfer werden aber nicht einfach Täter, sondern schaffen eben eine ganz andere, neue Gemeinschaft der „Stimme der Vielen“ (Hölderlin), die der militärischen diametral gegenüber steht. Mit dem ersten akustischen Zeichen des Films, mit Trommelwirbel und Soldatenlied hat gerade die Tonebene von MORITURI eine geschichtliche Spur begründet, durch die der Bezug auf ein historisches Ereignis und die Frage nach dessen Aneignung und damit Deutung sich als ästhetische Erfahrung von Geschichtlichkeit entpuppt. Diese besteht für den Zuschauer darin, den Vorgang der Entstehung von Formen historischen Denkens als Entfaltung der audiovisuellen Welt des Films in ihrer spezifischen Dauer sinnlich erfahren und so erst begreifen zu können.
- 1Vgl. etwa Flückiger (2001), Chion (1990, 1996, 1999), Altman (1992).
- 2Zuletzt prominent Elsaesser/Hagener (2007:165f.).
- 3Ich verstehe filmische Bildräume im Unterschied zu filmischen Handlungsräumen, in denen die kinematografischen Operationen als Effekte der Erzählung gelten, als komplexe audiovisuelle Vorgänge, die sich im Zuschauer realisieren und sich ihm als eine Erfahrung ästhetischer Weltprojektionen entfalten. Vgl. Kappelhoff (2006).
- 4Etwa Bordwell/Thompson (1993).
- 5Gertrud Koch hat diesen Zusammenhang herausgearbeitet. Vgl. Koch (2012).
- 6Noch bei Elsaesser/Hagener (2007:169f.) taucht nur der frühe Tonfilm-Kritiker Arnheim vom Ende der 1920er Jahre auf, nicht der Befürworter aus Film als Kunst von 1932.
- 7Vgl. etwa Silverman (1988), Türschmann (1994).
- 8Vgl. Groß (2015). Darin sind die hier formulierten Thesen ausführlich belegt.
- 9Liedtext: Gustav Wilhelm Harmssen (1914); Vertonung: Hans Hertel. Das Lied fehlte während des NS in keiner einschlägigen Gesangsfibel.
A.K. (1948): MORITURI. In: Film-Echo. 2. Jg. Nr. 18/19, 15.10.1948.
Altman, Rick (Hg.) (1992): Sound Theory, Sound Practice. London, New York.
Anonym (1948): Menschen hart am Abgrund. Der Weg in die Freiheit. In: Der Spiegel. 2.10.1948, S. 22.
Arnheim, Rudolf (1979): Film als Kunst [1932]. Frankfurt/Main.
Arnheim, Rudolf (2004): Der tönende Film [1928]. In: Ders.: Die Seele in der Silberschicht. Medientheoretische Texte. Photographie – Film – Rundfunk. Frankfurt/Main, S. 67-70.
Balázs, Béla (1984/1): Der sichtbare Mensch [1924]. Schriften zum Film, Bd. 1. Berlin.
Balázs, Béla (1984/2): Der Geist des Films [1930]. Schriften zum Film, Bd. 2. Berlin.
Bathrick, David (1999): Radio und Film für ein modernes Deutschland: Das NS-Wunschkonzert. In: Irmbert Schenk (Hg.): Dschungel Großstadt. Kino und Modernisierung. Marburg, S. 112-131.
Becker, Wolfgang / Schöll, Norbert (1995): In jenen Tagen: Wie der deutsche Nachkriegsfilm die Vergangenheit bewältigte. Opladen.
Brink, Cornelia (1998): Ikonen der Vernichtung.Öffentlicher Gebrauch von Fotografien aus nationalsozialistischen Konzentrationslagern nach 1945. Berlin.
Bordwell, David / Thompson, Kristin (1993): Film Art. An Introduction. New York.
Chion, Michel (1990): Audio-Vision. Sound on Screen. New York.
Chion, Michel (1996): Das akusmatische Wesen: Magie und Kraft der Stimme im Kino. In: Meteor 6/1996.
Chion, Michel (1999): Sanfte Revolution... und rigider Stillstand. In: Meteor 15/1999.
Dillmann-Kühn, Claudia (1990): Artur Brauner und die CCC: Filmgeschäft, Produktionsalltag, Studiogeschichte 1946-1990. Frankfurt/Main.
Ebert, Jürgen (1977): Kracauers Abbildtheorie. In: Filmkritik. 21. Jg., H. 4/1977, S. 196-217.
Elsaesser, Thomas / Hagener, Malte (2007): Ohr und Ton. In: Dies.: Filmtheorie zur Einführung. Hamburg, S. 163-187.
Flückiger, Barbara (2001): Sound Design. Die virtuelle Klangwelt des Films. Marburg.
Geisthövel, Alexa (2009): Auf der Tonspur. Musik als zeitgeschichtliche Quelle. In: Martin Baumeister et al. (Hg.): Die Kunst der Geschichte. Historiographie, Ästhetik, Erzählung. Göttingen, S. 157-168.
Groß, Bernhard (2015): Die Filme sind unter uns. Zur Geschichtlichkeit des frühen deutschen Nachkriegskinos. Trümmer-, Genre-, Dokumentarfilm. Berlin.
Hans, Jan (2004): Musik- und Revuefilm. In: Harro Segeberg (Hg.): Mediale Mobilmachung I. Das Dritte Reich und der Film. Mediengeschichte des Films Band 4. München, S. 203-228.
Kappelhoff, Hermann (2006): Die Dauer der Empfindung. Von einer spezifischen Bewegungsdimension des Kinos. In: Margrit Bischof et al. (Hg.): e_motion. Hamburg, S. 205-220.
Koch, Gertrud (2012): Kracauer zur Einführung. Hamburg.
Koepnick, Lutz (2002): The Dark Mirror. German Cinema Between Hitler and Hollywood. Berkeley.
Kracauer, Siegfried (1984): Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films [1947]. Frankfurt/Main.
Kracauer, Siegfried (1985): Theorie des Films [1960]. Frankfurt/Main.
Lowry, Stephen (1991): Pathos und Politik. Ideologie in Spielfilmen des Nationalsozialismus. Tübingen.
Loewy, Hanno (2003): Zwischen Judgement und Twilight. Schulddiskurse, Holocaust und das Courtroom Drama. In: Sven Kramer (Hg.): Die Shoah im Bild. München, S. 133-170.
Nancy, Jean Luc (1988): Die undarstellbare Gemeinschaft. Stuttgart.
Pleyer, Peter (1965): Deutscher Nachkriegsfilm 1946-1948. Münster.
Reichel, Peter (2004): Erfundene Erinnerung. Weltkrieg und Judenmord in Film und Theater. München.
Rentschler, Eric (1996): The Ministry of Illusion. Nazi Cinema and its Afterlife. Cambridge, London.
Shandley, Robert R. (2001): Rubble Films: German Cinema in the Shadow of the Third Reich. Philadelphia.
Silberman, Marc (1995): German Cinema. Texts in Context. Detroit 1995, S. 66-80.
Silverman, Kaja (1988): The Acoustic Mirror. The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema. Bloomington, Indiana.
Türschmann, Jörg (1994): Film – Musik – Filmbeschreibung. Zur Grundlage einer Filmsemiotik in der Wahrnehmung von Geräusch und Musik. Münster.
Witte, Karsten (1995): Lachende Erben, Toller Tag. Filmkomödie im Dritten Reich. Berlin.
Witte, Karsten (2004): Film im Nationalsozialismus. Blendung und Überblendung. In: Wolfgang Jacobsen et al. (Hg.): Geschichte des deutschen Films. Stuttgart, Weimar, S. 117-166.