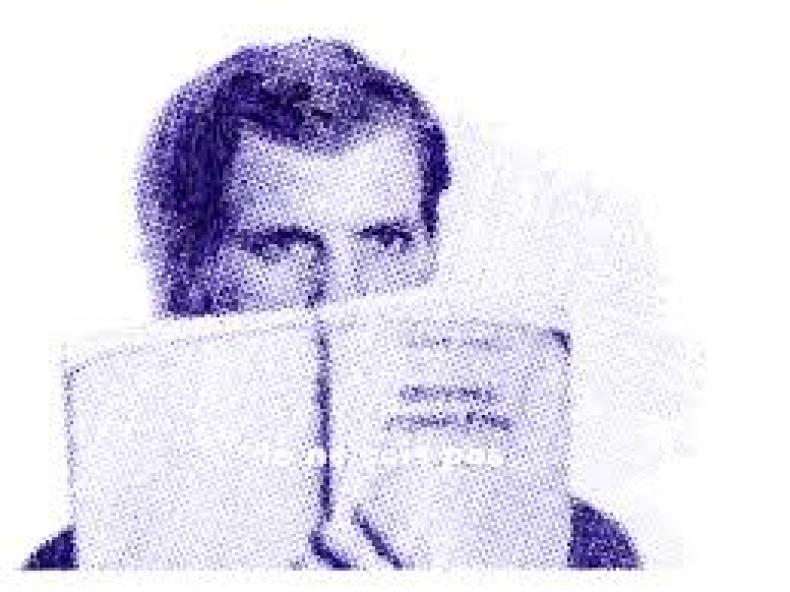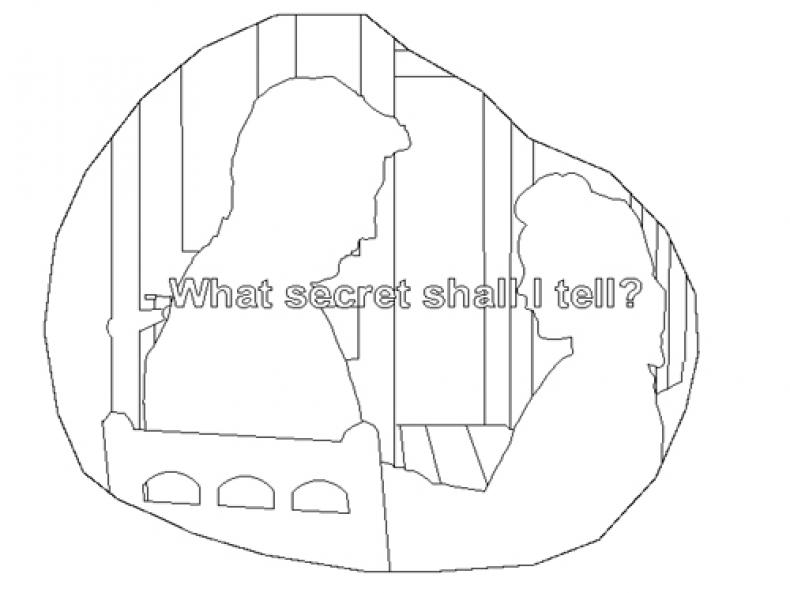Kleine Formen
Kleine Formen
Chancen, Risiken und Nebenwirkungen
Jede Form, egal wie klein sie ist, hat ihre Geschichte. Nein, sie hat mindestens zwei. Zum einen ist sie Teil einer Geschichte der Formen, auf die sie reagiert, in der sie steht und gegen die sie sich stellt. Anstelle des in Blei gegossenen Worts „Tradition“ (man suchte schließlich den Neuanfang) hat Jurij Tynjanov in den Zwanziger Jahren von „Evolution“ gesprochen, um den historischen Wandel künstlerischer Formen zu beschreiben. Die Evolution der Formen: Das ist die erste, wenn man so will: die offizielle der beiden Geschichten. Aber jede Form ist auch Bestandteil einer persönlichen und inoffiziellen Geschichte; der Geschichte dessen, der mit ihr zu tun hat, indem er sie liest oder in ihr, an ihr, möglicherweise auch gegen sie arbeitet.
Meine erste bewußte Begegnung mit der „kleinen Form“ fand Anfang der Neunziger Jahre statt. „Ganz ohne Veranlassung mußte ein Mann plötzlich gähnen, und zwar hier, vor unseren Augen. Das veranlaßt uns, diese Geschichte, die wir gerade begonnen haben, augenblicklich zu beenden.“ Ein Freund, der sich zu diesem Zeitpunkt, 1992, zum Verlagskaufmann ausbilden ließ und später erfolgreich ein Germanistikstudium abbrach, hatte mir das Buch geschenkt, in dem diese und 83 weitere „ziemlich kurze Geschichten“ zu lesen waren, wie es im Untertitel heißt. Natürlich hatten wir im Deutschunterricht kurze Prosa gelesen, der Wunsch, Indianer zu werden war mir also geläufig, aber das hier war anders.
„Ein Mann, der unter anderen Umständen gar nicht erwähnenswert wäre, kam, ich erwähne das hier nur am Rande, eines Morgens aus einer Tür. Alles, was wir erwarten, ist jetzt ein Schuß, ein Stoß oder Sturz. Das ist wirklich nicht viel verlangt.“
Mehrere Männer heißt der schmale Band der Frankfurter Verlagsanstalt, gelb eingeschlagen, er liegt jetzt, 17 Jahre später, vor mir auf dem Schreibtisch.1 Der Name des Autors, Ror Wolf, sagte mir nichts, seine Fußballcollagen und die erstaunlichen Enzyklopädien, die er unter dem Namen Raoul Tranchirer publizierte, lernte ich erst später kennen. Wenn ich der Besonderheit dieser Kürzestgeschichten – ein Gattungsbegriff, den Heimito von Doderer, ein anderer Meister in diesem Genre, mindestens benutzt, wahrscheinlich auch geprägt hat2 – nachspüre, fällt mir auf: So kurz die Geschichten sind, so vollständig ist die narrative Welt, die sie schaffen. Da ist zuerst nichts als eine weiße Seite, und dann, relativ unvermittelt, sind da ein Protagonist und eine Bewegung oder Handlung, ein Ablauf mit Beginn und Ende. Mehr noch: Die erzählte Welt, so skizzenhaft sie entworfen ist, enthält auch uns, ihre Leser (die Beobachter) mit unseren Erwartungen und Antizipationen. Und sie enthält den Autor. Es ist ein inkludierendes Erzählen, das um seine Form, um die Möglichkeiten und Konventionen des Erzählens und schließlich um unsere Formatierungen weiß. Die diesem Schreiben entgegengesetzten Erzählformen, die langen, umständlichen und verschnörkelten, die ausschweifenden, psychologischen und epischen, die vielhundertseitigen, dünndruckpapierverdächtigen, sind also auch in diesen zwei Sätzen anwesend. Ror Wolfs Erfindung, nicht weit, aber weit genug entfernt vom Witzeerzählen, schien mir darin zu liegen, in einer schlanken und eleganten, zugleich effizienten und ökonomischen Bewegung und Sprache all dies aufzurufen und zugleich mit trockener Lakonie beiseitezurücken.
Das hat, wendest du etwas ungeduldig ein, nicht besonders viel mit Filmen zu tun. Gut, sage ich, kann sein, aber viel mit dem Schreiben über Filme.
Der prägnanten Kurzform, die in wenigen Sätzen einen erzählten Raum (einen Film) noch einmal neu und anders aufgreift, antippt, nachzeichnet, begegnete ich später wieder. Am prominentesten in Frieda Grafes Filmtips, die über ihren Publikationsort in der „Süddeutschen Zeitung“ hinaus seit 1993 auch gebündelt in einem Buch verfügbar sind.3 Über einen Zeitraum von 16 Jahren, zwischen 1970 und 1986, wies Frieda Grafe auf Filme im Münchener Kinoprogramm hin, meist in wenigen Worten und Zeilen. Die Vielfalt dieser Texte ist erstaunlich, mal zitiert sie einen Satz des Regisseurs, mal gibt sie ein entschieden launiges Urteil ab, mal charakterisiert sie sehr treffend den Hauptdarsteller oder stellt den Film in eine aufschlussreiche Reihe anderer Filme. Nicht nur Frieda Grafe war in dieser Form zuhause. Bereits seit Anfang der sechziger Jahre hatte auch Helmut Färber, ebenfalls in der „Süddeutschen Zeitung“, zahllose solche Texte publiziert; „Vor der Leinwand notiert“ hieß eine der Rubriken. Und im Berliner „Tagesspiegel“ schrieb Peter Nau in den siebziger Jahren Filmhinweise, die heute ebenso zu Unrecht vergessen sind wie Färbers frühe Kurzprosa. Für den Tageszeitungsleser, erzählte Peter Nau mir einmal, sollten diese Texte so überraschend wirken, als seien sie kurze Märchen mitten im Dickicht der Fakten. In einem dieser Märchen begegnet uns, wie bei Ror Wolf, schon wieder ein Mann:
„Ein junger Mann (Peter Kern), durch Körperfülle benachteiligt, allein, hat nur seinen Zeitungskiosk, in dem er arbeitet. Abends, wenn er nach Hause kommt, hört er träumend Peter-Kraus-Platten. Vor Müdigkeit schläft er ein. In den Zeitungen, die er verkauft, stehen Preisausschreiben, und eines Tages ist er der Sieger: drei Wochen New York. Was dem naiven, gutmütigen und immer freundlichen Mann aus Bayern dort widerfährt, wie er sich verliebt, Kornblumenkönig wird, als Preis eine Kuh gewinnt und wegen dieser Kuh seine Königin (Barbara Valentin) verliert, das ist in dieser musikalisch-filmischen Enten-Produktion (Regie und Drehbuch: Walter Bockmayer), die auf der Straße der Sehnsucht dahinfährt, leicht gemacht. Wehmut und Anteilnahme, aus der Distanz. (Bundesrepublik).“4
Jeder dieser Kurztexte ist Schauplatz einer Verhandlung. Er bezieht sich nicht nur auf einen Film, sondern spricht zugleich über grundsätzliche Optionen des Schreibens über Filme. Vielleicht greift er nur einen Schnitt oder eine halbe Dialogzeile heraus oder entscheidet sich, gar nicht über den Film, sondern über den Zustand der Kopie oder die unbarmherzige Härte der Kinositze zu schreiben. (Nau: „Leider sind die Kopien, vor allem die der die ‚Mysterien’ ergänzenden Valentin-Tonfilme, in einem Zustand, der mich zwingt, dem Kino nahezulegen, das Programm so schnell wie möglich abzusetzen.“) Und selbst, wenn die Autorin oder der Autor nur „beim Film selbst“ bleibt (aber was soll das sein?), stehen mit Beschreibung und Erzählung zwei literarische Techniken zur Verfügung, die in Romanen und Erzählungen stets neu ausbalanciert werden und deren Gleichgewicht man mutwillig verschieben oder zerstören kann; so wie der Nouveau Roman in der Nachfolge Flauberts versucht hat, das Erzählen experimentell zu verlangsamen, ja fast zum Stillstand zu bringen, indem die Autoren es mit immer dichteren und dickeren Schichten von Beschreibung zudeckten; für Claude Simon beispielsweise ist das als „fotografische“ Ästhetik beschrieben worden5 – das lässt daran denken, dass Roland Barthes in seinem letzten Buch den Haiku und die Fotografie in unmittelbare Nachbarschaft rückt.6
„Mit Hilfe der Askese soll es manchen Buddhisten gelingen, eine ganze Landschaft aus einer Saubohne herauszulesen.“ Das ist der erste Satz und zugleich der Klappentext des stw-Bändchens von Roland Barthes S/Z.7 In einer klassischen Gründungserzählung der Filmwissenschaft8 steht dieses Buch, gemeinsam mit Althussers „Ideologischen Staatsapparaten“ an der Wiege der akademischen Disziplin. Barthes zerlegte Balzacs Novelle Sarrazine in ihre linguistischen Bestandteile; er brach sie herunter in eine Vielzahl von kleinen und noch kleineren Elementen. Ich habe darin immer nicht nur die Zuspitzung des strukturalistischen Furors, sondern zugleich auch seine ironisch-pedantische Überwindung erkennen wollen. Die „analyse textuelle“ in den entstehenden Film Studies orientierte sich an Barthes’ Technik, aber auch wenn sie den Film umstandslos zum Text erklärte, hat sie nicht darüber hinwegsehen können, dass Filme anders an- oder abwesend sind als Buchstaben und Sätze. Barthes hatte Balzacs Novelle, oder besser: er hatte weiße Papierseiten mit schwarzen Buchstaben vor sich liegen. Das war das Material, das er fein säuberlich zerteilte in syntaktische und semantische Häppchen. Er schrieb, stelle ich mir vor, in die Zeilen hinein, notierte Dinge am Rand, vielleicht schnitt er sogar kleinere Einheiten mit einer Schere aus ihm heraus. Wie aber soll man etwas Vergleichbares mit einem Film machen? In den Siebziger Jahren, als Raymond Bellour, Thierry Kuntzel, Stephen Heath, Nick Browne und andere eine Übertragung von Barthes’ Vorgehen auf die Analyse von Filmen versuchten, war es nur am Schneidetisch möglich, den Film zu Analysezwecken „vor sich“ zu haben. Immerhin, die Standbilder wanderten in die Texte hinein, um zumindest einen Teil der analytischen Bewegung nachvollziehbar zu machen. Stichproben, Fragmente, „kleine Formen“, die metonymisch mit dem größeren Ganzen des Films in Verbindung standen. Das war eine erste, tastende Antwort auf Fragen, die bis heute zentral geblieben sind: Wie zitiert man einen Film? Worüber schreibt man eigentlich, wenn man „über Film“ schreibt?9
Ein Schnitt und ein Zeitsprung: Im Sommer 2004 entschieden Michael Baute und ich uns dazu, 93 Autorinnen und Autoren einzuladen, über die 93 Minuten von Charles Laughtons Film THE NIGHT OF THE HUNTER (USA 1955) zu schreiben. „Die Idee ist“, schrieben wir an unsere Wunschkandidaten, „den Film in 93 Teile von je einer Minute Länge zu zerteilen und je einen Autoren / eine Autorin über eine einzelne Minute schreiben zu lassen. Hintergrund war der Wunsch, anders, als es in herkömmlichen Texten über Filme oft der Fall ist, nah an den Bildern und Tönen entlang zu schreiben (was Interpretation, Assoziation und all das natürlich überhaupt nicht ausschließt).“ Per Losverfahren sollte jeder und jede zu „seiner“ individuellen Minute kommen, die fertigen Texte würden wir anschließend wieder in der Chronologie des Films als fortlaufenden Text zusammensetzen. Das Ergebnis heißt Minutentexte und ist im Herbst 2006 als Buch erschienen.10 Laughtons Film ist keine „Kleine Form“, aber wir machten uns daran – vielleicht entfernt verwandt mit Barthes’ Impuls, aber zum Glück, ohne ausdrücklich an ihn zu denken –, ihn mutwillig in eine Vielzahl von kleinen Formen zu zerteilen. In vorsätzlicher Missachtung filmischer Einheiten wie „Szene“ oder „Einstellung“ takteten wir unser Seziermesser nach Minuten und setzten alle 60 Sekunden einen Schnitt, der ohne Rücksicht auf Verluste mitten durch Dialogsätze, Streicherakkorde und Kameraschwenks ging. Uns war nicht klar, wie man als Autorin oder Autor mit dieser Zumutung umgehen würde: Einen fragmentarischen Kurzfilm von einer Minute vor sich zu haben, der aber zugleich Teil einer größeren Struktur war, zu der sich der eigene Text verhalten musste. Um genau diese Unklarheit ging es uns. Das Ganze war zumindest in einer Hinsicht ein sehr eigennütziges Unternehmen: Wir hatten einen Vorwand geschaffen, über ein Jahr lang in ständiger Vorfreude auf neue Texte von Autorinnen und Autoren zu leben, deren Blick auf Filme wir schätzten und auf deren „Lösungen“ der Text-Bild-Fragen wir gespannt waren. Mit jedem Text justierten sich die Erwartungen neu, auch und vor allem die eigenen Kriterien, was wir für „gelungene“ oder „angemessene“ Texte hielten.
Falls es uns nicht schon zu Beginn des Projekts klar war, wurde es im Laufe seiner Verwirklichung immer deutlicher: Diese Form der Zusammenarbeit war nur unter den Bedingungen von DVD und Internet möglich. Nicht nur, weil die Fragmentarisierung von Filmen, mit allen Vor- und Nachteilen, die sie mit sich bringt, heute allen geläufig ist. Auch, weil im in Weblogs eigene, kleine und weniger kleine Textformen entstanden waren (und teils schon wieder verschwunden sind), die wir im Buch dabei haben wollten. Ganz abgesehen vom logistischen Aufwand bei 93 Leuten, mit denen zu kommunizieren ist. Fünf oder zehn Jahre zuvor hätte man das nicht oder nur unter Aufbietung großer Kräfte verwirklichen können.
Raymond Bellour charakterisierte den Film einmal als „unauffindbaren Text“.11 Er meinte das ganz grundsätzlich, im Sinne einer Kluft zwischen dem flüchtigen Zeitmedium Film und dem Geschriebenen, das sich in einem ganz anderen Medium mit einer völlig anderen Zeitlichkeit dazu verhält. Trotz der prinzipiellen Distanz zwischen Film und Text haben der Schneidetisch und, in demokratisierter Form: der DVD-Player die Filme erreichbarer gemacht. Es müsste sich etwas am Schreiben ändern, wenn zwar nicht das Celluloid, aber doch alle grundlegenden Funktionen des Schneidetischs durch die DVD für jeden greifbar werden. Das Anhalten, das Vor- oder Zurückspulen, die genaue, geduldige Beobachtung und Beschreibung. Kann man die Nähe zum Gegenstand provozieren? In den Minutentexten schwebte uns etwas Derartiges vor: Indem wir den Gegenstand verkleinerten, hofften wir die Details zu vergrößern. Aus der Verkleinerung der Form sollte eine Vergrößerung der Nähe resultieren. Ob das gelungen ist, muss jeder selbst entscheiden.
Parallel zu den Minutentexten schrieb ich Texte, die genau 100 Worte lang waren. Jetzt fällt mir auf, dass diese Texte in vielem das Gegenteil dessen waren, was wir im Minutentexte-Buch versuchten. Wenn das eine ein Buch „über“ die DVD und die dadurch bedingte (trügerische) Gegenwart des Films in der Analyse ist, handeln die 100-Worte Texte vom Kino und der (auf andere Weise trügerischen) Vergangenheit des Films in der Erinnerung. Ausgangspunkt für diese Form war zunächst ein sozialer Zusammenhang: Ein paar Jahre lang trafen wir uns mit einigen Leuten regelmäßig, um Videos und DVDs zu schauen. Die Gespräche danach waren oft interessant und ich dachte, man sollte einzelne Gedanken daraus aufschreiben, auch, weil vieles so schnell in Vergessenheit gerät. Zu Beginn erschienen daher am Tag nach unseren Treffen 100-Worte-Texte im Weblog „new filmkritik“.12 Das verlor sich nach einer Weile (dieses Sich-verlieren ist eine der schönen Eigenheiten des Weblogschreibens), aber ich blieb noch etwa ein Jahr lang dabei. Man vergisst so viel, zumindest einen kleinen Zipfel wollte ich vom Kinobesuch zurückbehalten. Eigentlich immer schrieb ich über die Erinnerung an einen Film. Kurz nachdem ich ihn gesehen hatte, manchmal auch erst später. Die völlig kontingente Regel – 100 Worte, keins mehr, keins weniger – ermöglichte es mir, die Sache überhaupt anzugehen.
„Der Entschluss, über einen Film exakt 100 Worte zu schreiben, ist ebenso sinnvoll oder sinnlos wie der, einen Roman zu verfassen, in dem der Buchstabe ‚e’ nicht vorkommt. In beiden und in vielen anderen Fällen spannt die kontingente Regel einen Rahmen auf, und dieser Rahmen schreibt mit am Text, der ohne ihn anders aussähe. Etwas über ein Jahr lang habe ich über jeden Film, den ich gesehen habe, einen 100-Worte-Text geschrieben. Eine Auswahl von 70 Texten ist in dieser Ausgabe von ‚flypaper’ abgedruckt. Für mich sind es Gedächtnisstützen, aneignende Versuche, beiläufig-zentralen Leinwandeindrücken eine Form zu geben: Screen Tests.“,
schrieb ich später (in 100 Worten), als das erste von zwei Heften „flypaper“-Heften erschien.13 Das Verhältnis zwischen Detail und Ganzem ist hier anders. Der große Zusammenhang eines Films wird in eine quantitativ genau berechnete, kurze Form gebracht. Der gesamte Film wird im Text miniaturisiert. Bei den Minutentexten war es eher so, dass ein herausgelöster, kleiner Ausschnitt in der überproportional genauen Beschreibung ins geradezu Monströse vergrößert wird.
In der Überschrift dieses Texts habe ich angekündigt, auch über die „Risiken und Nebenwirkungen“ der „kleinen Form“ schreiben zu wollen. Das ist nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Chancen liegen offener zu Tage. An den kurzen Formen gefällt oder gefiel mir, dass sie zeigten: Es kann und darf prinzipiell alles ein Text sein: Eine Liste, ein Link, ein Satz. Was vielleicht am wenigsten ein Text sein kann, ist der Film. Mit den Risiken und Nebenwirkungen dagegen wollte ich andeuten, dass jede Regel zu einer Zwangshandlung werden kann und ein Textrezept immer ein Verfallsdatum hat. Man muss bemerken, wann es besser ist auszusteigen. Mich hat auch irritiert, als vor nicht all zu langer Zeit ein Web 2.0-Konzern auf die Idee kam, in der kleinen Form ein Geschäftsmodell zu erkennen. Er programmierte ein Tool, das es dem Benutzer erlaubte, nicht mehr als 140 Zeichen zu publizieren. Inzwischen bin ich skeptisch diesen Formfindungen gegenüber. Mit weniger Enthusiasmus als bei den Minutentexten und den „100-Worte-Texten“ schreibe ich seit einer Weile Geschichten über das Kino, die nicht länger als ein Satz sein dürfen. Noch dazu steht der Anfang des Satzes fest, er lautet immer: „Die Geschichte vom“ (oder, je nachdem, was folgt: „Die Geschichte von der“). Einhundert solche Geschichten sollen es werden, ich nummeriere sie ganz nüchtern durch (1/100, 2/100, inzwischen bin ich bei 30/100 angekommen). Hier ist es so – auch das fällt mir erst jetzt auf –, dass gar nicht die Filme im Vordergrund stehen, weder auf DVD noch als Kinoerinnerung. Es geht eher um das unübersichtliche Getümmel von Instanzen und Personen, die zentral oder peripher, beruflich oder ohne Hintergedanken, mit dem Kino zu tun haben. Ein Beispiel: „Die Geschichte von der Lehrerin, die auf die telefonische Empfehlung, sie solle mit ihren Schülern im Rahmen der Schulkinoinitiative ELEPHANT von Gus van Sant ansehen, mit der Einschätzung reagierte, für diese Klasse sei ein Tierfilm sicher nicht das richtige.“ Die kürzeste Geschichte geht so: „Die Geschichte der Dreizehn“, sie ist unter unmittelbarem Einfluss von Jacques Rivettes OUT 1 (FRANKREICH 1971) entstanden. Eine etwas längere und repräsentativere: „Die Geschichte vom Missverständnis, dass der Dokumentarfilm-Regisseur ‚an einem Straub-Film arbeite’, womit, wie sich dann herausstellte, in Wirklichkeit ein Film über die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Staub gemeint war.“ Man kann diese Geschichten als kleine Rätsel auffassen. Zu jeder dieser anonymen und durch die formale Regel fiktionalisierten Figuren gibt es einen „realen“ Gegenpart. Mir schwebt vor, dass nach einhundert solchen Sätzen ein merkwürdiges Mosaik (oder vielleicht eher ein Bestiarium) dessen entstanden sein wird, was „Kino“ ist, ohne jeden Anspruch auf Repräsentativität oder Vollständigkeit, eher im Sinne einer etwas verzerrten und kuriosen Wahrnehmung, wie sie die gewölbten Spiegel auf dem Jahrmarkt provozieren. Kann sein, dass das gelingt. Kann sein, dass es einfach nur das bleibt, was es ist: 100 kurze Geschichten über das Kino.
Die kleine Form eignet sich genausogut zum Scheitern wie jede andere auch.
- 1Ror Wolf: Mehrere Männer. Vierundachtzig ziemlich kurze Geschichten, zwölf Collagen und eine längere Reise, Frankfurt/Main: Frankfurter Verlagsanstalt 1992. Die beiden zitierten Geschichten dort auf den Seiten 73 und 9.
- 2Vgl. Heimito von Doderer: Kurz- und Kürzestgeschichten, in: Ders.: Erzählungen, hg. von Wendelin Schmidt-Dengeler, München: dtv 1980, S. 211-345.
- 3Filmtips Frieda Grafe, hg. von Fritz Göttler und Heiner Gassen, München: KinoKonTexte 1993; später im Rahmen der „Schriften“ erneut publiziert, dort allerdings um die Hinweise auf Spielzeiten und Kinos gekürzt (Frieda Grafe: Ins Kino! Münchener Filmtips 1970 bis 1986, Berlin: Brinkmann und Bose 2007).
- 4Peter Nau: „Flammende Herzen“. Ich kann die genaue Quellenangabe dieses Kurztexts nicht mehr rekonstruieren, mir liegt nur der Zeitungsausschnitt vor.
- 5Vgl. Irene Albers: Photographische Momente bei Claude Simon, Würzburg: Königshausen und Neumann 2002.
- 6Vgl. Roland Barthes: Die Vorbereitung des Romans. Vorlesung am Collège de France 1978-1979 und 1979-1980. Aus dem Französischen von Horst Brühmann, Frankfurt/Main: Suhrkamp 2008, insbesondere die Sitzung vom 17. Februar 1979, S. 126-127.
- 7Roland Barthes: S/Z, aus dem Französischen von Jürgen Hoch, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1976.
- 8Vgl. etwa Judith Mayne: Cinema and Spectatorship, London/New York: Routledge 1993, S. 13ff.
- 9Siehe dazu auch André S. Labarthes Text „Citer le cinéma“, in deutscher Übersetzung hier zu lesen.
- 10Minutentexte, hg. von Michael Baute und Volker Pantenburg, Berlin: Brinkmann und Bose 2006.
- 11Raymond Bellour: Der unauffindbare Text, aus dem Französischen von Margrit Tröhler und Valérie Périllardin: montage/AV 8/1/1999, S. 8-17 [Themenheft „Film als Text. Bellour, Kuntzel“].
- 12www.newfilmkritik.de.
- 13Siehe http://virb.com/flypaper.