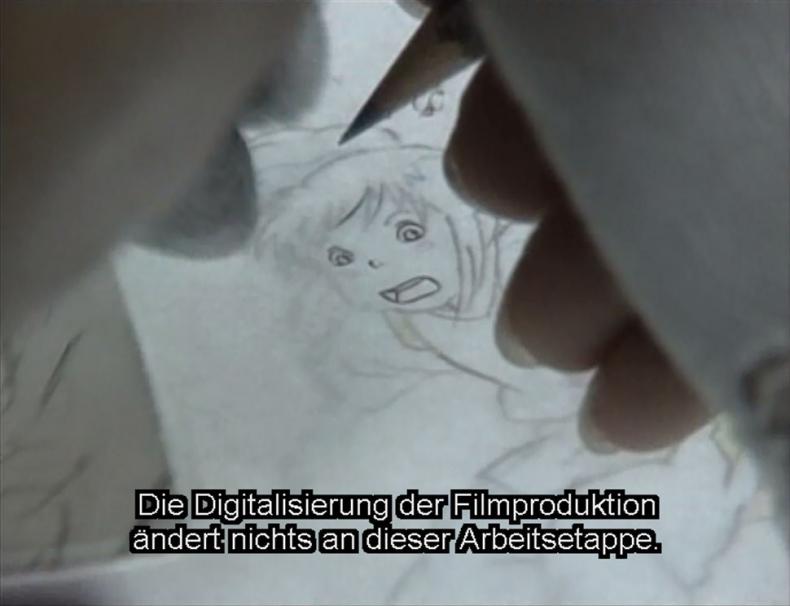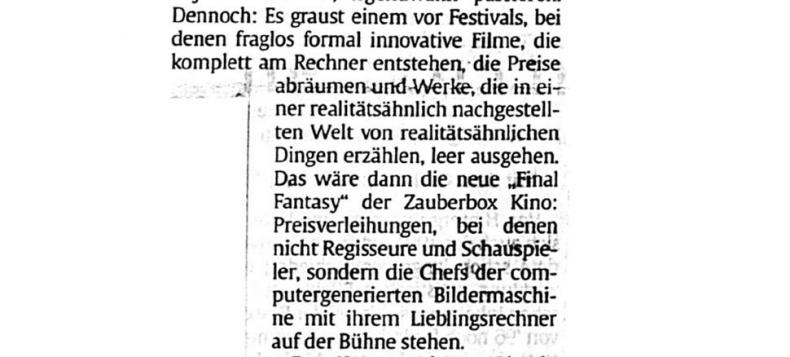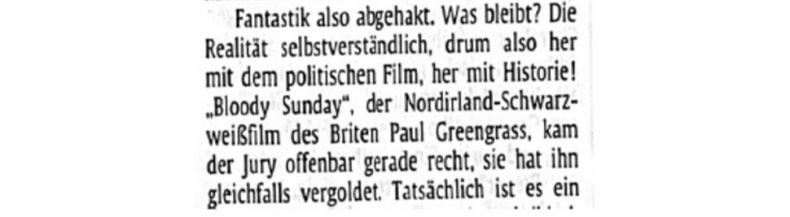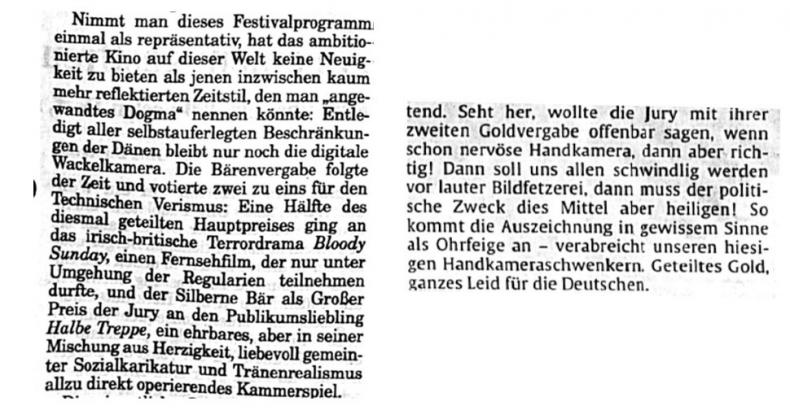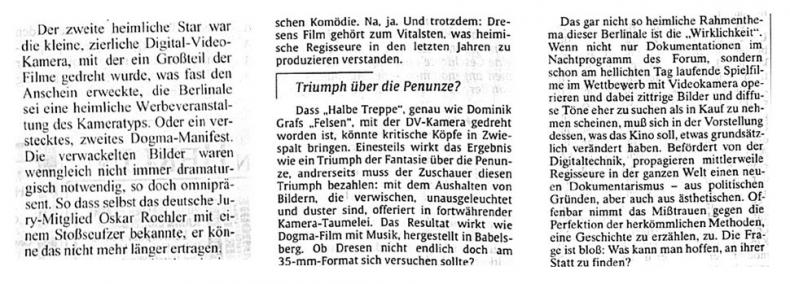Zweifelhafte Zuschreibungen
Zweifelhafte Zuschreibungen
Hybride Ästhetiken im Wettstreit um die Bären
Filmfestivals postkinematografisch befragen
Wenn unter Post-Cinema zeit- und örtlich fluide digitale Bewegtbildformationen verstanden werden, welche immer schon medienimmanent in unserem global vernetzten Alltag eingebettet sind, dann könnte man Filmfestivals als gallische Dörfer an den sich beständig ausdehnenden Rändern des ‚postkinematografischen Imperiums‘ ansehen: Sind sie doch zeit- und örtlich klar begrenzte, mehr oder weniger huldvolle Ehrerbietungen an das Kino und somit – so scheint es – weit entfernt von einer ‚post-cinematic condition‘. Doch was zeichnet diese ‚condition‘ aus und inwiefern ist sie produktiv an die wissenschaftliche Betrachtung von Filmfestivals und die Frage nach filmischen Digitalästhetiken anschlussfähig?
In der facettenreichen Theoriebildung rund um das Post-Cinema sieht Elisa Linseisen primär den Versuch „Film und Kino in Bezug auf ihre Wandelbarkeit anders oder neu zu denken“ und dabei insbesondere das „Verhältnis von Kino und Digitalität zu ihrer je spezifischen Transformierbarkeit“ (Linseisen 2018: 204) zu thematisieren. Eine konkretisierte Annäherung an den Begriff schlägt Vinzenz Hediger im Gespräch mit Miriam de Rosa über das ‚Post‘ des Postkinematografischen vor. Ihm nach diene der Begriff dazu, die Krise der Triade „canon + index + apparatus/dispositif“ (Hediger/de Rosa 2017: 13) zu betrachten, anhand derer sich die Filmwissenschaft seit ihrer Akademisierung in den 1970er Jahren legitimierte, um somit auch die Zeitlichkeit des Kinos und dessen, was darunter verstanden wird, in den Blick zu nehmen:
‚Cinema’ was, first, a catalogue of canonical works, roughly the canon of auteur cinema; ‚cinema’ was, second, a photographic medium whose core material property was photomechanical reproduction, or, to phrase it in the terms of Peircean semiotics, a medium based on ‚indexicality’; and ‚cinema’ was, third, a dispositif (or, to put it in more properly Althusserian terms, an apparatus), an aggregation of a public space, a technology of projection, and the social habit of movie-going and the mental framework of spectatorship. (Hediger/de Rosa 2017: 13-14)
Die von Hediger genannte Begriffstriade – Kanon, basierend auf Autor(*inn)enkino, Index, kurz gedacht als fotografischer ‚Abdruck‘ einer vorfilmischen Wirklichkeit und Dispositiv/Apparatus als Idee vom Kino als ideo-technologisch gesetzten, gemeinschaftlichen Filmerfahrungsraum – bezeichnen die bekannten Säulenheiligen der klassischen Cinéphilie, welche auf Filmfestivals in verschiedener Ausprägung nach wie vor von großer Relevanz sind. Doch ebenso wenig wie die genannte Triade stabil ist, ist die Cinéphilie klassisch – vielmehr hat sie sich abseits des Kinos neue Denk- und Erlebnisräume des Films angeeignet (vgl. Hagener/Valck 2008). Auch vor Filmfestivals macht das ‚Werden‘ nicht halt: Innerhalb der Filmfestivalstudien, welche circa zeitgleich mit dem bis heute anhaltenden Festivalboom sowie mit dem Begriff des Post-Cinema Anfang der 2000er Jahre aufkamen, gibt es zahlreiche Ansätze, die die Wandelbarkeit von Filmfestivals historisch, ökonomisch sowie anhand sozial-politischer Fragestellungen in den Blick nehmen (vgl. Loist 2019) – einen Fokus auf filmische Ästhetiken und deren Verhandlung im Kontext von Festivals sucht man jedoch vergebens.
Deswegen werden Filmfestivals hier als Spielfelder kinematografischer Ästhetiken verstanden, in denen Filme niemals für sich allein stehen, sondern immer schon im Agon/Wettstreit mit anderen.1 In der Folge rücken drei Filme des Berlinale-Wettbewerbs 2002 unter das Brennglas, die die Kategorien von Kanon, Index und Dispositiv auf besondere Art und Weise herausfordern. Die Frage nach dem Digitalen wird hier weniger als Bruch, vielmehr als Wechselspiel aus ästhetischen Zuschreibungen, Genres, Techniken sowie Produktionsprozessen bemerkbar. Als leicht angerostetes Gerüst des Spielfelds soll die Triade Kanon/Index/Dispositiv dienen, die ich vorab in aller Kürze auf Filmfestivals bezogen einführe.
Dispositiv: Event
Obwohl sich digitale Abspieltechniken ab circa 2010 breitenwirksam in den Kinosälen durchgesetzt haben, hat sich das ‚klassische‘ Kinodispositiv nicht verändert: Noch immer projiziert ein nicht sichtbarer Abspielapparat das filmische Bewegtbild in einem dunklen Saal auf eine Leinwand. Festivals bauen nicht nur auf dieser Schauanordnung auf, sie stilisieren sie erfolgreich zum Event. Anhand von ausgeflaggten Filmpremieren in palastartigen Kinosälen, Wettbewerben sowie Special Screenings und anschließenden Filmgesprächen mit Filmschaffenden und Stars, wird im besten Fall ein an einem überschaubaren Ort stattfindendes Filmfestival für eine begrenzte Dauer ein populäres Event mit potentiell Gemeinschaft und Identität stiftendem Charakter.
Im Fokus dieses Textes steht mit der Berlinale eines der ,taktangebenden‘ europäischen Filmfestivals (vgl. Fahle/Hediger/Sommer 2012: 24). Trotzdem Jahr für Jahr tausende Filmfestivals mit verschiedensten programmatischen Ausrichtungen, diversem Zielpublikum und unterschiedlichen kulturpolitischen Hintergründen stattfinden – die Filmeinreichungs-Onlineplattform FilmFreeway2 zählt derzeit an die 8000 weltweit – nehmen die ‚großen Drei‘ (Berlinale, Cannes, Venedig) eine dezidierte Deutungshoheit darüber ein, welche Techniken und ästhetischen Konventionen (und Autor*innen) auszeichnungswürdig sind, was (ein sehenswerter) Film ist und wo dessen Zukunft liegt: im Kino bzw. im Festival-Circuit (d.h. von Festival zu Festival zu wandern), um gegebenfalls von einer mit Festivals kooperierenden Streaming-Plattform gefeatured zu werden. Somit arbeiten Filmfestivals auch proaktiv mit postkinematografischen Distributions- und Exhibitionsmöglichkeiten an ihrer marktwirtschaftlichen Profitabilität, indem sie die Festivalerfahrung durch Streaming-Deals mit TV-Sendern (arte, RAI) oder VOD-Plattformen (festival scope, mubi, realeyz) teilweise auslagern oder Expanded Cinema- sowie Virtual-Reality- und Games-Formate in ihre Filmmärkte oder Nebenschienen integrieren. Filmfestivals haben es folglich geschafft, die digitalen Kanäle gewinnbringend zu nutzen, um ihre Reichweite via Web- und VOD-Präsenz zu auszudehen, aber gleichzeitig am Kinodispositiv festzuhalten und dieses als einzig legitime Vorführanordnung für Filme des offiziellen Wettbewerbsprogramms zu propagieren.
Kanon: Wettbewerb
Was will ein Film im Wettbewerb eines Festivals? Er möchte einen Preis oder zumindest mediale Aufmerksamkeit gewinnen. Anhand dieser beiden Faktoren ist einerseits eine weitere Vermarktung, andererseits ein Fortleben des Films im kollektiven Filmgedächtnis gewährleistet. So ist es nur folgerichtig, dass im Bereich der Filmfestivalforschung Ansätze verfolgt werden, welche Filmgeschichte mit Festivalgeschichte verknüpft denken (vgl. Loist 2019: 19) und dass vor allem der ‚Autorenfilm‘ nicht länger nur anhand einzelner Namen oder nationaler Zugehörigkeit, sondern auch anhand der Repräsentation und Hervorbringung durch Filmfestivals und -kritik beleuchtet wird (vgl. Frisch 2011). Zu Recht wird ferner die Intransparenz der Auswahlpraktiken großteils männlich-weißer künstlerischer Entscheidungsträger und Kritiker beanstandet, deren Geschmacksurteile den westlichen Kanon prägen, bzw. andere filmische Formen ausgrenzen (vgl. Rastegar 2012/Rich 2004). A-Filmfestivals platzieren Langspielfilme unbekannter Regisseur*innen, aber auch andere Genres und Gattungen, wie beispielsweise Animations-, Experimental-, Dokumentar- und Kurzfilme, tendenziell in weniger lukrativen Nebenschienen, was ihre Chancen auf Aufmerksamkeit mindert. Allerdings rüttelt die durch digitale Technik möglich gewordene Vielzahl von alternativen Diskussions- und Meinungsbildungskanälen sowie teils kollektiv und kostengünstig produzierten Langspielfilmen an bestehenden Qualitätsparametern der Festivals in Bezug auf Autor*innenschaft, aber auch hinsichtlich Materialfragen, die mehr und mehr Teil des Qualitätsdiskurses werden. Obgleich der Unterschied zwischen 4/8K-Digitalfilm und einer 35mm-Kopie mit bloßem Auge kaum auszumachen ist, ist die Frage, ob ein Film analog oder digital gedreht wurde, zur Gretchenfrage mutiert, deren eindeutige Beantwortung durch hybride Herstellungs-, Kopier- und Projektionsprozesse erschwert wird.
Index: Vor/Filmische Prozesse
Die Frage nach ‚dem Digitalen‘ versetzt, wie wir gesehen haben, den Dispositiv-Begriff von Filmfestivals insbesondere hinsichtlich Fragen der Distribution in Bewegung. Auch rütteln digitale Techniken mit ihren diversifizierten und zugänglicheren Produktions- und Kommunikationsmöglichkeiten an bestehenden Vorstellungen bezüglich der Frage, was (ein sehenswerter) Film ist und sein kann. Angesichts digitaler Filmtechniken ist der Index jedoch der meist kontestierte Begriff der Triade, da damit ein nach wie vor starkes Relevanzkriterium des Films infrage gestellt wird: Der physisch nachvollziehbare Bezug zur Realität.
Anknüpfend an Tom Gunnings Text Moving away from the Index. Cinema and the Impression of Reality möchte ich kurz auf das komplexe Verhältnis von Indexikalität und Realismus eingehen, da dieses Begriffspaar in der Folgeanalyse tonangebend ist. Den Grund für die Nähe der beiden Konzepte sieht Gunning in der Engführung der Peirceschen Begriffe mit der Bazinschen Filmtheorie begründet. Unter Berufung auf Peter Wollens Essay Semiology of the Cinema führt Gunning aus, dass die Vorstellungen des Index bei Peirce und Bazin ähnlich sind – „the existential bond between sign and object“ – doch er erkennt auch einen essentiellen Unterschied: „[…] whereas Peirce made his observation in order to found a logic, Bazin wished to found an aesthetic.” (Wollen zit. n. Gunning 2012: 45). Gunning schließt daraus, dass das Bazinsche Indexverständnis eine Suchbewegung nach spezifischen Verfahren des Filmischen ist, mit besonderem Augenmerk auf ästhetisch-formalen und narrativen Strategien. Insofern ist es auch hinsichtlich der Frage nach dem digitalen Filmbild wenig zielführend, den Bezug zur vorfilmischen Wirklichkeit rein auf einen apparativ-fotografisch begründeten Index-Begriff zu stützen. Anstatt dessen schlägt Gunning vor, Film über integrative Aspekte zu verstehen, die verschiedenste Gattungen des Films miteinbeziehen. (Vgl. ebd: 49-50) Dazu plädiert er in Anlehnung an die frühe französische Filmtheorie (Dulac, Delluc, Epstein), aber auch an Eisenstein, Kracauer, Metz und Deleuze für eine größere Wertschätzung des Bewegtbildes (und nicht lediglich der beweglichen Kamera) als ein strukturelles Merkmal des Films.
In der folgenden Analyse des Berlinale-Wettbewerbs 2002 muss der Index-Begriff jedoch noch weiter aufgebrochen werden. In Anschluss an Bazins Wertschätzung filmischer Technik könnte man darunter auch einen Verweis auf vor/filmische Prozesse verstehen, die sich aus formal-ästhetischen Kriterien ableiten lassen. So stellt sich mir, ausgehend von den paratextuellen Zuschreibungen zu den Wettbewerbsfilmen der Berlinale 2002, die Frage, inwiefern Film auf sich selbst (seine Medialität/Materialität) und auf seine vor/filmischen Produktionsprozesse verweist und was dies möglicherweise über ‚digitale‘ Ästhetiken und ‚analoge‘ Realitäten aussagt.
Drei Preise, Drei Techniken, Drei Ästhetiken: Der Berlinale Wettbewerb 2002
Die Berlinale 2002 ist aus mehreren Gründen interessant: Zum einen wird der langjährige und oft vonseiten der Kritik unter Beschuss stehende Leiter Moritz de Hadeln von Dieter Kosslick abgelöst, dessen lockere Art und erster Wettbewerb unter dem Motto ‚accept diversity‘ anfangs noch auf positiv-verhaltene Reaktionen stoßen. Weiters ist unter der beginnenden ‚Ära‘ Kosslick der deutsche Film nach langer Dürrezeit wieder im Wettbewerb vertreten – die Erfolge von Andreas Dresen, Tom Tykwer, Fatih Akin, Dominik Graf et al. Anfang der 2000er Jahre sind unter anderem auf die Programmpolitik des neuen Berlinale-Leiters zurückzuführen. Ferner wird die erste Berlinale nach dem 11. September 2001 durch das Diskurs-Rahmenprogramm ‚Framing Reality‘ begleitet, welches sich mit Gästen wie Gertrud Koch, Harun Farocki und Slavoj Žižek der Frage nach dem Vermögen des Dokumentarischen nach 9/11 widmet. Und schließlich kommt es erstmalig dazu, dass mit CHIHIROS REISE INS ZAUBERLAND (Japan 2001) ein mithilfe digitaler Techniken produzierter Animationsfilm den Goldenen Bären gewinnt. Diesen muss er sich allerdings ex aequo mit BLOODY SUNDAY (IR/GB 2001), einem ursprünglich für das britische Fernsehen hergestellten Analogfilm teilen. Den Silbernen Bären für die beste Regie gewinnt HALBE TREPPE (D 2001), der trotz oder gerade wegen billiger Digital-Video-Ästhetik die Kritik überzeugt. Zwar werden noch alle Filme – unabhängig ihres Produktionsmaterials – als 35mm-Projektion im klassischen Kinodispositiv gezeigt, doch durch die Juryentscheidungen des Jahrgangs werden insbesondere starre Vorstellungen von Index und Kanon massiv herausgefordert.
Goldener Bär Part I: CHIHIRO
Offenbar war es Dieter Kosslick ein Anliegen, unter Bezugnahme auf das Jahrgangsmotto und die allererste Berlinale 1951, als Disneys CINDERELLA (USA 1950) einen goldenen Bären in der Kategorie Musikfilm gewann (Knörer/Seeliger 2002), erstmals wieder einen Animationsfilm in das Wettbewerbsprogramm zu integrieren. Wie im allerersten Perlentaucher Berlinale-Onlineblog nachzulesen ist, wurde CHIHIROS REISE INS ZAUBERLAND jedoch von den meisten Kritiker*innen nicht als ernstzunehmende Konkurrenz im Rennen um die Bären anerkannt:
Die Kritiker wenigstens scheinen dem Werk wenig Verständnis oder Interesse entgegenzubringen; in ungewöhnlich großer Zahl verließen sie die Pressevorführung, der Applaus blieb spärlich. Eine beinahe peinliche Angelegenheit war dann die Pressekonferenz, auf der allerdings nur der Produzent des Films anwesend war – eine Grußbotschaft Miyazakis wurde über Video eingespielt. Keine zwanzig Leute verloren sich im sonst so dicht gedrängten Rund, ein großer Teil davon japanische Korrespondenten. (Knörer 2002)
Während der zitierte Ekkehard Knörer die Juryentscheidung begeistert begrüßt, da mit ihr der „vielleicht größte lebende Meister des Animationsfilms“, (ebd.) Hayao Miyazaki, auf einem europäischen A-Festival gewürdigt werde, stehen einige seiner Kolleg*innen der Entscheidung milde überrascht bis kritisch gegenüber. Ein wahres Schreckensszenario beschwört Jan Schulz-Ojala vom Tagesspiegel aufgrund der Tatsache, dass im Vorjahr in Cannes und Venedig mit SHREK (USA 2001) aus den DreamWorks Studio und Richard Linklaters WAKING LIFE (USA 2001) ebenfalls (teil-)animierte Filme im Wettbewerb zu sehen waren. Mithilfe digitaler Techniken hergestellte Animationsfilme müssen nun also als Konkurrenten im Kampf um die Preise der illustren europäischen A-Festivals akzeptiert werden und greifen somit Index und Kanon, aber auch die Integrität von Festivals generell an:
Schulz-Ojala geht von einer profilmischen Realität aus, welche ‚realitätsähnlich‘ zu sein hat und sieht dies beim Animationsfilm im Vorhinein nicht erfüllt. Doch auch in der Animationsfilmtheorie spielen Realitätsähnlichkeit und Mimesis eine zentrale Rolle. So wirft Erwin Feyersinger im Themenschwerpunkt zum Animationsfilm von montage AV einen kritischen Blick auf das „Realismus-Abstraktions-Kontinuum“ – einem gängigen Analysemodell der Animationsforschung, anhand dessen versucht wird, die zahlreichen Hybridformen, die seit Anbeginn des Animationsfilms existieren und seit der Digitalisierung an Zahl zugenommen haben, an deren Realitätstreue bzw. Abstraktionsgrad zu messen (vgl. Feyersinger 2013). In derselben Ausgabe entwickelt Ivo Ritzer für das japanische Anime einen anderen Begriff von Hybridität abseits des genannten Modells. Zum einen bezieht auch er sich auf die Realitätseffekte des Animationsfilms, indem er den Animefilm mit US-amerikanischen Animationsfilmen Disneyscher Prägung hinsichtlich deren unterschiedlicher Anwendung Realismus-generierender filmischer Effekte, wie Kontinuität, ‚lebensechter‘ Bewegungsabläufe sowie Ton-Bild-Synchronität vergleicht, wobei er beim Anime eine „Ästhetik der Diskontinuität“ verwirklicht sieht (Ritzer 2013: 135). Zum anderen schlägt er vor, Anime als hybride Medienphänomene zu begreifen, welche zwischen Manga-Reihen, TV-Serien und Computerspielformaten oszillieren (vgl. Ritzer 2013: 136). Und tatsächlich findet man auch zu Produktionen des auf den Kinovertrieb spezialisierten Studio Ghibli, welches sichtlich für eine andere Anime-Ästhetik als die von Ritzer herangezogene TV-Serie AFRO SAMURAI (J/USA 2007) aus dem Studio Gonzo einsteht, passende Computerspiele auf speziellen Fandom-Seiten: Ein direktes Computerspiel zu CHIHIROS REISE sucht man zwar vergebens, doch der Verfasser empfiehlt ersatzweise das PC-Spiel Stardew Valley, welches in der ideologischen Grundkonzeption CHIHIROS REISE ähnele: „The game has a strong anti-capitalist message, which resonates with a lot of Miyazaki’s own beliefs expressed through characters such as No Face and Sen’s parents in Spirited Away.“ (Yarwood 2018, Herv. im Original) – eine Verwandtschaft, die die Bildgestaltung nicht betrifft:
Der bereits zitierte Kritiker Jan Schulz-Ojala schneidet mit der ‚Realitätsähnlichkeit‘ aber auch einen anderen zeitgenössischen Diskurs an, welcher der Angst vor der Ersetzbarkeit menschlicher Produktionskraft Ausdruck verleiht: Anstelle von Regisseur*innen und Schauspieler*innen stünden nun „die Chefs der computergenerierten Bildermaschine mit ihrem Lieblingsrechner auf der Bühne“ (Schulz-Ojala 2002). Durch die polemische Aussage des Kritikers wird humane, ‚kreative‘ Arbeitskraft mit der Rechentätigkeit von Maschinen kontrastiert. Übertragen auf die Herstellung von Film handelt es sich hier um eine nicht haltbare Gegenüberstellung von produktiver Filmarbeit, welche sich einer klassischen Aufnahmeanordnung aus vorfilmischer Realität und Kamera bedient, versus einer Filmarbeit, welche angeblich „komplett am Rechner“ (ebd.) entstünde – also ohne Kamera – und ohne die Referenz auf eine profilmische Wirklichkeit rein in der Postproduktion erzeugt wird.
Offenbar bemüht darum, dieses bekannte Vorurteil der reinen Maschinenarbeit zu widerlegen, nimmt das japanische Making-of von CHIHIROS REISE den äußerst ‚menschelnden‘ Herstellungsprozess des Animefilms in den Blick. Zu sehen sind emsige Hände beim Zeichnen, Miyazaki, der lebhaft mit seinem Team diskutiert, und schließlich die familiären Strukturen, die sich aufgrund des Zeitdrucks und der daraus resultierenden Überstunden in den Arbeitsalltag einschleichen: gemeinsam wird bis spätnachts gekocht, gearbeitet und getrunken.
Die implizite Frage nach dem Vorhandensein bzw. der Abwesenheit der Kamera in CHIHIROS REISE weist allerdings in eine ontologische Richtung: Ist Film, der ohne Kamera entsteht, Film?3 Ein Rückblick in die Animationsfilmgeschichte zeigt, dass die klassische Animationsfilmtechnik sehr wohl spezielle Kameras (Rostrum- oder Animationskameras) verwendete, um durch das Abfilmen der bemalten Hintergründe, mit bis zu fünf darüber geschichteten transparenten Zelluloidfolien, die Einzelbilder in Bewegung zu versetzen. Meist wurde hierfür 16mm-Film benutzt, ausnahmsweise 35mm- oder gar 70mm-Film für hochbudgetierte Disney-Kinoproduktionen (vgl. Clements/McCarthy 2015). Obwohl in CHIHIROS REISE die Kamera mutmaßlich bereits durch einen Scanner und ein Animationsprogramm ersetzt wurde (welche verfahrenstechnisch der Animationskamera ohnehin ähnlicher sind als Filmkameras), handelt es sich um einen äußerst konventionell produzierten Animefilm: gezeichnete Figuren auf Papier und transparentem Zelluloid werden vor aquarellartigen Hintergründen in Bewegung versetzt. Der ‚Trickfilm‘ CHIHIROS REISE hat nicht – wie CGI-Technik – die Absicht zu ‚tricksen‘ und Nichtreales als real auszustellen. In seiner handgemalten Fantastik verweist er hingegen auf kollektive Herstellungsprozesse und auf Bewegung als grundsätzlichen Aspekt des Filmischen abseits einer beweglichen Filmkamera und der vorfilmischen Wirklichkeit. Somit ist er – trotzdem er von Knörer als Autorenfilm markiert wird – eine Attacke auf Index und Kanon und wird gerade deshalb ex aequo bei der Preisvergabe mit einem ‚Realfilm‘ gepaart.
Goldener Bär Part II: Historie und Realismus
Paul Greengrass’ Film BLOODY SUNDAY ist der andere Gewinner des Goldenen Bären 2002, doch trotz ausgesprochen unmärchenhafter Thematik, wird es ihm von der Kritik noch weniger gedankt. Wohingegen die Entscheidung für CHIHIROS REISE teils Bewunderung für den Mut der Jury unter dem Vorsitz von Mira Nair hervorgerufen hat, wird die ex aequo Prämierung für die britisch-irische Produktion BLOODY SUNDAY als Rettungsbojen-Taktik interpretiert. Nach dem Kanon-Ausreißer aus Japan brauche man nun Legitimierung durch Historie und Realismus.
Auf der thematischen und ästhetischen Ebene ist Greengrass‘ Film folglich das Gegenstück zu CHIHIROS REISE, dennoch ist er als bereits im Fernsehen ausgestrahlte TV-Produktion ein Angriff auf das Kinodispositiv. Dabei handelt es sich keineswegs um den ersten Fernsehfilm, der auf der Berlinale gekürt wurde – beispielhaft sei hier die ZDF-ORF-Koproduktion DER STILLE OZEAN (Ö/BRD 1983) unter der Regie von Xaver Schwarzenberger genannt. Die Prämierung einer Fernsehproduktion ist also nicht neu. Als neu – so meine These – könnte man die Art und Weise ansehen, mit der Greengrass einerseits die Mittel des Fernsehens historisiert und zur Schau stellt, andererseits inszenatorisch auf zeitgenössische Realismus-Ästhetiken zurückgreift. Zuerst ist da die Wahl des Materials: 16mm-Film war bis in die frühen 2000er Jahre das reguläre Trägermaterial für Fernseh- und Low-Budget-Produktionen, wurde aber dann rasant durch Digitaltechnik ersetzt. Aufgrund der Alternative durch digitale Techniken zur Filmherstellung erhält die spezifische Materialität des bislang weitgehend alternativlosen Zelluloidfilms eine andere Bedeutung. Der Trägerstreifen wird – wenn man so will – zum Ding des Films, das in seiner Historizität und Materialität sichtbar wird, ohne jedoch medienreflexiv darauf zu verweisen – eine gängige Praxis beim Experimental- und Kunstfilm. Bei aktuellen Spielfilmproduktionen zeigt sich, dass die Wahl des Materials nunmehr nicht länger eine reine Kosten- und Praktikabilitätsfrage ist, sondern eine künstlerische und produktionsästhetische Entscheidung. So schreibt Elena Meilecke zur formalen Ästhetik der Filme von Alice Rohrwacher:
Besonders gut zur Geltung kommt das Flirrend-Formlose dank eines Filmmaterials, das seinerseits für Kunstlosigkeit steht, für Low-Budget-Produktionen und Amateurarbeiten: Alle drei Rohrwacher-Louvart-Kollaborationen sind auf analogem 16mm-Schmalfilm gedreht. Louvart lässt die ‚Nachteile‘ des Materials – seine geringere Auflösung, das gröbere Korn – als ästhetische Gestaltungsmittel wirksam werden, die zu der naturalistischen, organischen und warmen Anmutung der Filme beitragen. Das 16mm-Format steht dabei auch in bewusster Spannung zur Gegenwart digitaler Filmproduktion, seine weiche Unschärfe ist das Gegenteil von High-Definition. (Meilecke 2019)
2001/2 markiert die Produktionszeit von BLOODY SUNDAY. Zu dieser Zeit existiert die Digital-Video-Technik circa ein halbes Jahrzehnt, sie hat sich jedoch erst ab 2002/2003 mit HD breitenwirksamer durchsetzen können. Bis dahin herrscht bei den erfolgreicheren Festivalfilmen vereinfacht gesagt eine dreifache Materialauswahl: Mini-DV, Super-16- und 35mm. Warum, so kann man sich fragen, wählt Greengrass Super-16mm? Zum einen ließe sich die Formatwahl arbeitsbiografisch begründen, kommt Greengrass doch selbst aus dem Bereich der Fernsehproduktionen; zum anderen könnte man sie – im Vorausgriff auf die oben ausgeführte Neubewertung des Filmmaterials – als formalästhetische Entscheidung ansehen, welche sich auf Film- und Fernsehgeschichte bezieht, insbesondere auf deren dokumentarische Formen und Reenactment-Strategien. Eine weitere These ist, dass der Analogfilm das Barthesche ‚es ist gewesen‘ in seinem materiellem Dasein bekunden und sich so dem potentiellen „Zweifel“ (vgl. Steyerl 2008: 7-9) des digitalen dokumentarischen Bildes nach 9/11 entziehen und der eigenen historischen Thematik mehr Gewicht verleihen möchte – ein Thema, das zeitgleich im Diskursprogramm ‚Framing Reality‘ der Berlinale 2002 diskutiert wurde. Sich in einen zeitgenössischeren Wahrheits-Diskurs einschreibend, orientiert sich BLOODY SUNDAY außerdem am Dogma-Stil. Dieses stilistische ‚zu viel‘ wird in den Kritiken oft diskreditierend angemerkt, führt aber auch dazu, dass dem zwischen verschiedenen Realismustechniken und -ästhetiken schwankende Film fälschlich eine Herstellung mittels DV-Kamera unterstellt wird. Laut Andreas Kirchner hängt diese gängige Verwechslung mit einer unscharfen Trennung zwischen DV- und Dogma-Ästhetik zusammen:
Die Begriffe sind deshalb so schwer zu trennen, weil sie zwar auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind – während sich der Begriff der DV-Ästhetik eigentlich auf die visuellen Effekte eines spezifischen Videoformats bezieht, beschreibt der Begriff Dogma-Ästhetik letztlich den Niederschlag des gesamten Dogma-Regelwerks –, sich aber partiell überlagern, da die Verwendung der DV-Kamera entgegen der ursprünglichen Intention zum Markenzeichen der Dogma-Bewegung wurde. (Kirchner 2011: 366)
Der Irrtum zeigt aber auch, dass BLOODY SUNDAY in mehrfacher Hinsicht hybrid ist: 16mm-Produktion, 35mm-Blow-Up; TV-Produktion, Kinopreis; und schließlich ein Historienfilm über ein politisch brisantes Thema gepaart mit zeitgemäßen formalen Bezugnahmen auf Dogma-Ästhetiken sowie schnell geschnittene Invasions-Dramaturgien ‚based on true events‘ à la BLACK HAWK DOWN (USA 2001), was bereits einen Vorgeschmack auf Greengrass‘ spätere BOURNE-Trilogie-Filme liefert.
Skasa-Weiß, Ruprecht (2002) Geteiltes Gold, ganzes Leid für Deutschland. Stuttgarter Zeitung, 18.02.2002.
Schlussendlich wird BLOODY SUNDAY gegen die deutschen Wettbewerbsbeiträge in Stellung gebracht, namentlich zu HALBE TREPPE und Dominik Grafs DER FELSEN (D 2001), die beide tatsächlich mit portabler Mini-DV-Kamera gedreht wurden. Im Spiegel der Berichterstattung wird BLOODY SUNDAY so zum Akteur in einer ‚verwischten‘ Kampfzone aus technischen, ästhetischen und national-politischen Zuschreibungen, dessen Hauptgegner der völlig anders operierende Realismus des deutschen Beitrags von Andreas Dresen ist.
Silberner Bär: DV-Intimitäten
Nostalgische Stimmen beklagen oft das Schwinden der Dunkelheit, das mit digitalen Techniken Einzug gehalten habe. Die Dunkelheit kann man hier im Sinne einer dispositiven Anordnung zwischen Betrachtenden, Betrachtetem und Technik vielfältig deuten: als Schwinden des Dunkels des Kinosaals durch Screens und neue Schauanordnungen, als Forderungen nach mehr Transparenz bezüglich Produktions- und Auswahlprozessen, oder auch hinsichtlich des filmischen Aufnahmeprozesses selbst. Robert Burleys Fotoband The Disappearence of Darkness (2013) ist hierfür ein illustratives Beispiel: der Fotograf dokumentierte den globalen Konkurs der Analogfilmindustrie seit Beginn der 2000er Jahre. Das Verschwinden des Dunkels im Buchtitel bezieht sich insbesondere auf die Entwicklung analoger Fotografie, wofür eine Dunkelkammer benötigt wird, aber auch auf die Tatsache, dass der*die Fotograf*in zwischen dem Abdrücken des Auslösers und dem Erhalt des fertigen Abzugs über das Endresultat ‚im Dunkeln‘ gelassen wird. Dieser zeitliche Unsicherheitsfaktor zwischen Bildproduktion und fertig entwickeltem Bild fällt mit der digitalen Kameratechnik weg. Während des Filmens stellt sich über den Monitor sowohl eine Direktheit als auch eine Distanz zum filmischen Aufnahmeprozesses ein. So beschreibt Barbara Flückiger die Dreherfahrungen der Regisseurin Anna Luif, die durch den Fokus auf den Monitor während des Drehprozesses eine für sie wohltuende Distanz zum Geschehen vor der Kamera einnehmen konnte. Eine andere Ansicht vertritt der Filmemacher Alexander Sokurov (RUSSIAN ARK, RU 2002), der in dem zwanghaften Sog, den die Bilder auf dem Monitor auf die Filmenden ausüben, eine Gefahr sieht. Genau diese Sogwirkung sieht Flückiger in der Dogma-Ästhetik übersetzt, welche „die Unmittelbarkeit des digitalen Bildes zum Stilmittel des Erzählens selbst“ erhebt (Flückiger 2013: 46). ‚Verwischt, duster, zittrig‘ lauten die Zuschreibungen zu solcherlei Filmen, deren Mini-DV-Kameras 2002 zum ‚heimliche[n] Star‘ der Berlinale werden:
Skasa-Weiß, Ruprecht (2002) Ein Dogma mit Musik. Stuttgarter Zeitung, 15.02.2002.
Siemons, Peter (2002) Das Nichts möglicherweise. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.02.2002.
Ein Bekenntnis zum Dogma bedeutet vor allem radikale Herstellung von Intimität und ein wohlwollendes sich-Aneignen der technischen Mängel. Dem kühlen, digitalen Standbild – das Ulrich Seidl zeitgleich zu seinem Markenzeichen macht – entrinnt Dresen in HALBE TREPPE durch eine ultrabewegliche Handkamera, die nah am improvisierenden Schauspielensemble bleibt. Verschmolzen mit den imperfekten technischen Gegebenheiten zieht die Ästhetik des neuen DV-Realismus, wie bereits das Cinéma Vérité und Direct Cinema, gegen hochbudgetierte Hochglanzproduktionen zu Felde und erhält dafür im Rahmen europäischer Filmfestivals – zumindest für kurze Zeit – einen Logenplatz.
Wohingegen BLOODY SUNDAY ein historisches Ereignis und CHIHIROS REISE eine imaginäre Reise als Ausgangspunkt ihrer Erzählungen wählen, beginnt Dresen in medias res mitten in einer alltäglichen Situation. Ein Pärchenabend beim gemeinsamen Urlaubs-Dia-Schauen. Durch die gemeinschaftliche Analogprojektion von Urlaubsfotos macht uns der Film auf seine Medienreflexivität aufmerksam: Der materielle Unterschied zwischen analogen, auf eine Leinwand projizierten Urlaubsfotografien und dem schlecht ausgeleuchteten, verpixelten Digitalbild, wird somit zu einer ästhetischen Verhandlung von Digital- und Analogästhetiken inklusive ihrer spezifischen Schauanordnungen. Doch die Behauptung des DV-Realismus, alltägliche Geschichten zu erzählen, ist insofern falsch, als dass auch hier – wie die Szene der Urlaubsfoto-Diashow einen Rückgriff auf Amateurfilmpraktiken andeutet – das Besondere und Dramatische des Alltags hervorgehoben wird: Bald wird die Balance der beiden Pärchen durch eine Affäre auf die Probe gestellt und bietet den improvisierenden Schauspieler*innen die Möglichkeit, die Vielfalt ihrer Gefühlspaletten auszuagieren. Schauspiel, Inszenierung, Narration und Kameratechnik werden so zu einem Amalgam, das sich gegenseitig bedingt und hervorbringt. Im Programm der Berlinale wird dies noch hervorgehoben:
Regisseur Andreas Dresen nennt im Abspann des Films seine vier Hauptdarsteller als Autoren. Tatsächlich haben sie diesen Ehe-Reigen mit ihm während der Dreharbeiten entwickelt. Die Schauspieler bestimmen Inhalt, Rhythmus und Dramaturgie dieser tragikomischen Alltagsgeschichte und geben dem Begriff des Schauspielerfilms eine neue Dimension. (Berlinale-Programm 2002)
Somit wird Dresens Film – wie schon CHIHIROS REISE – mittels Rückbezügen auf Autorschaft und Arbeitsweise bewertet. Doch wo CHIHIROS REISE fälschlicherweise eine enthumanisierte Produktion unter der Ägide eines Masterminds und seines Rechners unterstellt wurde, wird bei Dresen die kollektive Zusammenarbeit des gesamten Teams, welche durch die vielfältigen performativen Möglichkeiten, die anhand der Mini-DV-Technik befördert werden, positiv hervorgehoben. Der Intimitäts- und Realitätseffekt von HALBE TREPPE wird gegen Greengrass‘ reine „Behauptung von Authentizität“ (Rodek 2012), welche sich in einer radikalen Formsprache niederschlägt, in Stellung gebracht.
Fazit
Durch die zweifelhaften Zuschreibungen zu den Wettbewerbsfilmen 2002 wird deutlich, dass digitale Ästhetiken im Kino immer nur als transformatives Moment denkbar sind und sich medien-, material-, produktionsreflexiv zum Kino in seiner ‚Geschmeidigkeit‘ verhalten (vgl. De Rosa/Hediger: 11). Auf dem Spielfeld Filmfestival wird der Blick zudem auf das Konkurrenzverhältnis der Filme untereinander sowie auf ihr aktualhistorisches „Verhältnis zu Kino und Digitalität“ (Linseisen 2018: 204) gelenkt: BLOODY SUNDAY markiert das Ende des 16mm-Formats im Fernsehen und den Beginn einer Wiederaneignung des Analogfilms und dessen Bewerbung als Alternative zum digitalen Kino um 2015 (vgl. Dirk 2019: 63). Andreas Dresens gefeierte kollaborative Zusammenarbeit aus digitalen, technischen und menschlichen Akteur*innen könnte man, eingedenk der nach der Anfangseuphorie eintretenden beklagten „Omnipräsenz“ (Zander 2002) der verwackelten Mini-DV-Bilder, mit jüngeren Smartphone-Filmpraktiken und der Verhandlungen von Professionalität/Amateurismus und Autor*innenschaft/Kollaboration zusammendenken. Der japanische Anime CHIHIROS REISE ist aufgrund seiner hybriden Produktionsprozesse aus Hand- und Rechnerarbeit eine Provokation für verstaubte Kanon- und Indexbegriffe – auch weil es sich zudem um ein Märchen handelt, welches ein Mädchen auf der Schwelle zwischen Kindheit und Jugend ins Zentrum des Geschehens rückt. In seiner Hybridität verweist er aber auf transmediale Formen (vgl. Ritzer 2013), die derzeit nicht nur in Gestalt von Superhelden-Franchises das Kino sowohl im Multiplex- als auch im Arthouse-Sektor beleben.
Indem man institutionelle Rahmenbedingungen und Diskurse berücksichtigt, kristallisieren sich fließendere Vorstellungen von Kanon, Index und Dispositiv heraus. Insbesondere dem Konzept der Indexikalität kann man durch das Hinzukommen digitaler Alternativen zum Analogen neue Facetten abgewinnen: Abgesehen von der Bewegung, welche zentrales technisches und ästhetisches Merkmal der um die Jahrtausendwende populären Mini-DV-Kameras ist, spielt auch das filmische Material und der Arbeitsprozess eine Rolle bei der Bewertung der Wettbewerbsfilme 2002 und wirft somit Fragen nach vor/filmischer Wirklichkeit auf, die abseits des Abbilds zu denken sind. Gleichzeitig schwingt in dem Interesse an dahinterliegenden Prozessen eine gesellschaftspolitische Forderung nach Transparenz mit. Dieselbe Haltung kratzt auch an den Vorstellungen von Kanon und Autorschaft und führt zu einer Befragung von ästhetischen Urteilen und Meinungsbildung: Der Zaubertrank Kino, der in gallischen Dörfern gerne ausgeschenkt wird, wirkt zwar, doch möchte man auch wissen, wer ihn braut, was ihn wirksam macht und wogegen gekämpft wird.
- 1Agon verweist hier auf Chantal Mouffes Begriff der Agonistik. Mouffe geht davon aus, dass sich Politik immer in einem agonistischen Widerstreit ereignet, wobei die demokratischen Grundprinzipien des*der Gegner*in anerkannt werden, aber dennoch nach einer hegemonialen Vorherrschaft gestrebt wird. (vgl. Mouffe, Chantal (2014) Agonistik. Die Welt politisch denken. Frankfurt a.M.: Edition Suhrkamp). Daran angelehnt ließe sich meiner Meinung nach ein interessanter Analysemodus entwickeln, der Film politisch und in agonale Netzwerke eingebunden denkt und gleichzeitig deren ästhetisches Zusammenspiel nicht außenvor lässt.
- 2Film Freeway Submission Platform, https://filmfreeway.com/ (letzter Zugriff: 23.10.2019).
- 3Hier ist nicht der Platz um der Frage nach dem kameralosen Film nachzugehen, deshalb ein Verweis auf Olga Moskatovas Publikation Male am Zelluloid. Zum relationalen Materialismus im kameralosen Film. Berlin 2018.
Berlinale-Programm 2002: https://www.berlinale.de/de/archiv/jahresarchive/2002/03_preistr_ger_2002/03_Preistraeger_2002.html (letzter Zugriff: 09.10.2019).
Bruckner, Franziska/Feyersinger, Erwin (2017) Animationsfilmtheorie, in: Groß, Bernhard/Morsch, Thomas (Hg.) Handbuch Filmtheorie, S. 1–19, https://doi-org.uaccess.univie.ac.at/10.1007/978-3-658-09514-7.
Clements, Jonathan/McCarthy, Helen (2015) Technology and Formats, in: The Anime Encyclopedia: A Century of Japanese Animation. Berkeley: Stone Bridge Press, S. 1301–1304.
Denson, John/Leyda, Julia (Hg.) (2016) Post-Cinema: Theorizing 21st-Century Film. Falmer: Reframe Books.
Dirk, Valerie (2019) Was ist ein ‚ausgezeichneter‘ Film?, in: Bruckner, Franziska/Koch, Jana/Valent, Alexandra (Hg.) Filmfestivals, in Theory. Maske und Kothurn (3/2018), Wien: Böhlau, S. 53–65.
Fahle, Oliver/Hediger, Vinzenz/Sommer, Gudrun (Hg.) (2011) Orte filmischen Wissens. Filmkultur und Filmvermittlung im Zeitalter digitaler Netzwerke. Marburg: Schüren.
Feyersinger, Erwin (2013) Von sich streckenden Strichen und hüpfenden Hühnern. Erkundungen des Kontinuums zwischen Abstraktion und Realismus, in: montage AV, Vol. 22, Nr. 2, http://www.montage-av.de/a_2013_2_22.html (letzter Zugriff: 24.10.2019).
Fischer, Stefan (2013), Rollt den roten Teppich ein! Wer ein Filmfestival veranstalten möchte, macht das am besten im Netz, in: Seeßlen, Georg/Sucher, C. Bernd (Hg.) Postkinematografie. Der Film im digitalen Zeitalter. Berlin: Bertz+Fischer, S. 92–99.
Flückiger, Barbara (2003) Das digitale Kino: Eine Momentaufnahme. Technische und ästhetische Aspekte der gegenwärtigen digitalen Bilddatenakquisition für die Filmproduktion, in: montage AV, Vol. 12, Nr. 1, https://www.montage-av.de/pdf/121_2003/12_1_Barbara_Flueckiger_Das_digitale_Kino_Eine_Momentaufnahme.pdf (letzter Zugriff: 25.10.2019).
Frisch, Simon (2011) Mythos Nouvelle Vague: Wie das Kino in Frankreich neu erfunden wurde. Marburg: Schüren 2011.
Gunning, Tom (2012) Moving away from the Index. Cinema and the Impression of Reality, in: Koch, Gertrud/Pantenburg, Volker/Rothöhler, Simon (Hg.) Screen Dynamics. Mapping the Borders of Cinema. Wien: Synema 2012, S. 42–60.
Hagener, Malte/de Valck, Marijke (2005) Cinephilia: movies, love and memory. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Hediger, Vinzenz/de Rosa, Miriam (2017) Post-what? Post-when? A conversation on the ‘Posts’ of post-media and post-cinema, in: Cinéma & Cie: International Film Studies Journal, Vol. 26/27, No. XVI, S. 9–20, http://www.cinemaetcie.net/2016/01/27/cfe26/.
Kirchner, Andreas (2011) Mit Pixel und Korn. DV-Ästhetik und DOGMA-Film, in: Segeberg, Harro (Hg.) Film im Zeitalter Neuer Medien. Fernsehen und Video. München: Fink, S. 339–366.
Knörer, Ekkehard (2002) Reines Vergnügen: Der japanische Animationsfilm „Spirited Away“ (Wettbewerb), in: Außer Atem: Das Berlinale Blog. Perlentaucher, 10.02.2002 https://www.perlentaucher.de/berlinale-blog/2002/02/10/berlinale-5-tag.html (letzter Zugriff: 06.10.2019).
Knörer Ekkehard/Seeliger, Anja (2002) Ein Goldener Bär zum Jubeln und einer zum Weinen, in: Außer Atem: Das Berlinale Blog. Perlentaucher, 17.02.2002. https://www.perlentaucher.de/berlinale-blog/2002/02/17/ein-goldener-baer-zum-jubeln-und-einer-zum-weinen.html (letzter Zugriff: 06.10.2019).
Linseisen, Elisa (2018) Werden / Weiter / Denken. Rekapitulation eines Post-Cinema-Diskurses, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft. Heft 18: Medienökonomien, Jg. 10, Nr. 1, S. 203–209. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/2441.
Loist, Skadi (2019) Filmfestivals, theoretisch und methodisch. Zum Stand der Festivalforschung, in: Bruckner, Franziska/Koch, Jana/Valent, Alexandra (Hg.) Filmfestivals, in Theory. Maske und Kothurn (3/2018), Wien: Böhlau, S. 11–26.
Meilicke, Elena (2019) Die Frau mit der Kamera. Eine Annäherung in sieben Schritten und mit besonderem Fokus auf Hélène Louvart, in: nach dem film, No17: Feminismus und Film, https://www.nachdemfilm.de/issues/text/die-frau-mit-der-kamera (letzter Zugriff: 28.12.2019).
Rastegar, Roya (2012) Difference, Aesthetics and the Curatorial Crisis of Film Festivals, in: Screen, Vol. 53, S. 310–317.
Rich, B. Ruby (2004) Why Do Film Festivals Matter?, in: Iordanova, Dina (Hg.) (2013) The Film Festival Reader. St. Andrews: St. Andrews University Press, S. 157–166.
Ritzer, Ivo (2013) Transmedialität, Transgenerizität, Transkulturalität.
Zur axiomatischen Hybridität von anime, in: montage AV, Vol. 22, Nr. 2, http://www.montage-av.de/a_2013_2_22.html (letzter Zugriff: 24.10.2019).
Rodek, Hanns-Georg (2002) Blutiger Sonntag – Goldener Sonntag. Die Welt, 18.02.2002.
Steyerl, Hito (2008) Die Farbe der Wahrheit. Dokumentarismen im Kunstfeld. Wien: Turia+Kant.
Yarwood, Jack (2018) 8 Amazing Games That Every Ghibli Fan Must Own, https://www.fandom.com/articles/8-amazing-games-that-every-ghibli-fan-must-own (letzter Zugriff: 24.10.2019).