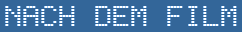Klasse auf dem (Bild-)Schirm
Klasse auf dem (Bild-)Schirm
Die Tagung ,Klassenfragen in der Film- und Medienwissenschaft‘ der Emmy-Noether Forschungsgruppe ,Filmische Diskurse des Mangels‘ in Berlin, 22.–23.06.2023
Lange galt Klasse hinter ,Race‘ und Gender als das vernachlässigte Stiefkind der Intersektionalität im Sinne Kimberlé Crenshaws. Mittlerweile ist Klassendifferenz als Konzept wieder im Kommen: Kassenschlager und Festivalabräumer wie PARASITE (ROK 2019), THE WHITE LOTUS (USA 2021–), SQUID GAME (ROK 2021–) und TRIANGLE OF SADNESS (S/UK/USA/F/GR/TR 2022) zeigen, dass die Themen Klassenkonflikte und soziale Ungerechtigkeit im modernen Mainstreamkino und Streamingangebot einen Zeitgeist zu treffen scheinen und lukrativ sind.
Auch aktuelle Publikationen der Sozial-, Kultur- und Medienwissenschaften widmen sich vermehrt der Frage, ob und wie der Blick durch die ,Klassenbrille‘ uns neue Möglichkeiten erschließt, Filme zu sehen, zu analysieren und unsere Definition von Klasse zu aktualisieren. Die Tagung ,Klassenfragen in der Film- und Medienwissenschaft‘, die von der Emmy-Noether Forschungsgruppe ,Filmische Diskurse des Mangels‘ der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf veranstaltet wurde, widmete sich daher der Frage, inwiefern gängige klassentheoretische Grundlagen hinterfragt und überarbeitet werden müssen.
Wird Klasse erst durch diskursive (filmische und wissenschaftliche) Praktiken reifiziert und reproduziert? Ist der Klassendiskurs deshalb nicht auch problematisch, vielleicht sogar klassistisch? Ist Prekarität primär materiell und ökonomisch definiert, oder bezeichnet sie eher eine Reihe von Praktiken und Affekten? Verkompliziert es unseren Klassenbegriff, wenn die ,klassische Arbeiter*innenklasse‘ heutzutage mehr verdienen kann als beispielsweise das Kognitariat (zu dem auch Filmschaffende häufig gehören)? Können filmische Mittel und Produktionsweisen zu einer Subversion der Klassenunterschiede beitragen? Und wie könnte eine solche utopische klassenlose Gesellschaft überhaupt aussehen?
Im Auftaktvortrag untersuchten Andrea Seier und Stephan Trinkaus, inwiefern sich in zeitgenössischen Filmen wie NOMADLAND (USA 2020), SONNE (A 2022) und TONI ERDMANN (D/A/F/CH/RUM/MCO 2016) ein postmeritokratisches Narrativ abzeichnet, das auf eine neoliberale Teleologie der sozialen Mobilität durch individuelles Empowerment verzichtet. Diese Filme konzeptualisierten Prekarität gewissermaßen als „Existenzweise der Richtungslosigkeit“, so Seier und Trinkaus, was sich formal unter anderem in einer weniger linearen Erzählweise widerspiegele. Ableiten ließe sich daraus eine affekttheoretische Aktualisierung des Klassenbegriffs im Sinne Lauren Berlants. SONNE und andere ,Banlieu-Filme‘ (die laut Seier überdurchschnittlich oft das Wort „Sonne“ im Titel tragen – wohl um einer gefürchteten Klassentristesse entgegenzuwirken) zeigten ein affektives, fragmentiertes, mediengestütztes Milieu, in dem das Ökonomische zumindest keine übergeordnete Rolle mehr spiele. Allerdings bringen viele dieser Filme Seier und Trinkaus zufolge (außer einem wohlwollenden, oft auch recht romantisierenden Blick) kein wirkliches Werkzeug zum Klassenkampf und keine politischen Forderungen hervor.
Die anschließende Diskussion drehte sich unter anderem darum, ob die Ungerichtetheit des Prekaritätsbegriffes im postmeritokratischen Kino zur Ungerichtetheit des Diskurses über Prekarität beitrage. Eine mögliche Maßnahme gegen diese teils als kontraproduktiv wahrgenommene Unbestimmtheit wäre zum Beispiel, Filme stärker einem ,Bechdel-Test‘ zum Thema Klasse zu unterziehen: Werden die Berufe der Protagonist*innen erwähnt? Sieht man sie bei der Arbeit etc.?
In ihrem Vortrag „Zwischen Ober- und Unterdeck“ analysierte Olivia Poppe die Figurenkonstellation Ober-/Unterschicht und den Themenkomplex Kapitalismus-/Imperialismuskritik im Gegenwartskino und -serienangebot. Ihre Analyse der Filmposter von PARASITE, TRIANGLE OF SADNESS und THE MENU (USA 2022) war ebenso aufschlussreich wie unterhaltsam: Auf diesen werde den Betrachtenden in einer unmissverständlichen Bildsprache vermittelt, dass es sich bei den genannten Werken um schwarzhumorige Kammerspiele handelt, in der ‚die Reichen‘ oberflächlich und unsympathisch, ‚die Armen‘ spitzfindig und lakonisch und die potenziellen Zuschauer*innen kultiviert seien und einen guten Filmgeschmack hätten. Zusätzlich werde den Zuschauenden etwas versprochen, was Poppe als „Klassensplatter“ bezeichnete: die Freude an der allmählichen und schließlich äußerst brutalen Eskalation des Klassenclashes. Dass in den beschriebenen Stoffen die ,Mittelklasse‘ größtenteils ausgeklammert werde, ist laut Poppe kein Zufall: Diese solle im Kino sitzen und sich als normative, relativ schuldlose Einheit wahrnehmen, deren politisch-moralische Reflexivität sie von einer korrupten und ausbeuterischen Oberschicht abgrenze.
In Anschluss an den Vortrag wurde unter anderem diskutiert, mit welchen filmischen Mitteln in den von Poppe genannten Beispielen die Protagonist*innen, die am ehesten der ,neuen Mittelklasse‘ entsprechen, als Identifikationsträger*innen konstituiert werden: So würde ihnen etwa eine schmeichelhaftere Bildsprache zuteil. Auch der ,Splatter‘-Aspekt des „Klassensplatters“ beträfe sie meist weniger als die anderen Charaktere. Es wurde auch die Frage aufgeworfen, ob der Konsum von ,Qualitätsserien‘ als solcher noch mit Prestige verbunden sei, oder die Selbstkonstituierung und der Selbstgenuss der ,neuen Mittelklasse’ ausschließlich durch die Rezeption der Inhalte vonstatten ginge.
Dass ein gewisses Maß an Selbstreflexion und eine verstärkte Selbstpositionierung im Klassengefüge auch für die Arbeit von Film- und Medienwissenschaftler*innen wichtig sei, argumentierte Christoph Büttner in seinem Vortrag. Indem er die „Kulturhaftigkeit von Klasse“ und die „Klassenhaftigkeit von Kultur“ problematisierte, zeigte er auf, inwiefern die medienwissenschaftliche Arbeits- und Klassenforschung von einem postfundamentalen Realismus von Klasse und Lohnarbeit profitieren könne. Klasse weise, wie alle anderen sozialen Kategorien, keine spontane Evidenz auf. Ihre Zeichen müssten kulturell vermittelt und decodiert werden. Sie sei gleichermaßen eine Wahrnehmungsstruktur (bzw. ein Interpretationsschema) wie eine dispositionelle Struktur. Man müsse daher stärker berücksichtigen, dass medientheoretische Überlegungen in einem gesellschaftlichen Machtgefüge stattfänden. Büttner bezog sich in seinem Vortrag u.a. auf Guido Kirsten und Jens Kastner: Die Annahme, dass die Klassengesellschaft durch ihre Repräsentation mitkonstituiert werde, bedeute nicht, dass diese Repräsentation allein die Klassengesellschaft konstituiere. Anhand von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe argumentierte Büttner dagegen, dass alle kulturellen Phänomene und somit auch Klassen ohne Repräsentation für uns nicht existieren würden (bzw. nicht wahrnehmbar wären). Doch auch diese konstruktivistischen Bedingungen ließen laut Büttner eine gewisse Form von Klassenrealismus zu: So könne Klasse als „soziale Fiktion mit realer Wirkmacht“ beschrieben werden. Auf Grundlage dieser Definition identifizierte er drei mögliche medienkulturwissenschaftliche Interventionen: Die erste sei es, den Klassenbegriff zu verkomplizieren. Die zweite sei es, Praktiken der Klassenwerdung und ihrer medialen Vermittlung zu untersuchen. Die dritte sei es, die diskursiven Effekte der Repräsentationen von Klasse genauer in den Blick zu nehmen.
Die an den Vortrag anschließende Diskussion war lebhaft und mit Sicherheit produktiv. Allerdings war sie so fachwissenschaftlich und abstrakt, dass ich als studentische Hilfskraft leider kaum etwas verstanden habe.
Daniel Fairfax verortete in seinem Vortrag den ,Underdog-Status‘ des Klassenbegriffes in der Theoriegeschichte der Medienwissenschaften. Genauer gesagt, untersuchte er die seiner Meinung nach symptomatische Abwesenheit der Klassenkategorie in der britischen Filmzeitschrift Screen. Deren Autor*innen erarbeiteten ab den 1970er-Jahren eine einflussreiche marxistische Filmtheorie, die eine wichtige Rolle bei der Etablierung der Filmwissenschaft gespielt habe. Fairfax argumentierte, dass die psychoanalytischen Elemente der ,Screen Theory‘ die des historischen Materialismus und der Ideologiekritik verdrängt hätten, sodass Screen ab den späten 1980er-Jahren nicht mehr wirklich als marxistisch gelten konnte. Die in Screen-Artikeln konzeptualisierte Auffassung von Ideologie sei zudem stark deterministisch gewesen und lasse keine relative Autonomie des Subjekts zu. Vereinfacht ausgedrückt, seien auf dieser theoretischen Grundlage emanzipatorische Tendenzen eines ,Klassenkampfes‘ ohnehin nicht möglich.
Im Anschluss wurde diskutiert, inwiefern Kunst laut Louis Althusser und Jacques Lacan die Möglichkeit hat, eine innere Distanz zur Ideologie einzunehmen. Es wurde auch besprochen, inwiefern das Kino ein kollektives Klassenbewusstsein schaffen könne. Interessant sei hier, dass Screen die Zuschauende nie als klassenspezifisches Subjekt mit bürgerlichen oder proletarischen ,Arten zu sehen‘ beschreibe. Auch über die Abwesenheit oder Ablehnung des britischen Sozialrealismus in Screen-Artikeln wurde diskutiert. Diese sei einerseits in einer gewissen Frankophilie der Autor*innen begründet. Andererseits spiele auch ihre bereits erwähnte Konzeption von Ideologie eine Rolle: Film solle einerseits eine Determinierung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse (in letzter Instanz) zeigen. Allerdings könne die Realität nie abgebildet werden – und das solle mit filmischen Mitteln auch nicht behauptet werden.
Elisa Cuter beschäftigte sich in ihrem Vortag mit autofiktionalen Filmen über das sogenannte Kognitariat. Diese Klasse mehr oder weniger prekär lebender Künstler*innen und Intellektueller bekomme immer stärkeren Zuwachs: Massenintellektualisierung, Selbstverwirklichungsdiskurse und eine Zunahme immaterieller Arbeit führten zu einer Prekarisierung und Proletarisierung der intellektuellen Praxis. Die von Cuter ausgewählten Filmbeispiele thematisieren dabei, inwiefern das Kognitariat eher Opfer oder Komplize eines flexiblen Kapitalismus ist oder ob Künstler*innen nicht gewissermaßen von der Logik des Marktes befreit sind. Julian Radlmaiers SELBSTKRITIK EINES BÜRGERLICHEN HUNDES (D/I 2017) etwa trage den Selbstbezug des Künstlers schon im Titel und beschreibe das Kognitariat als privilegierte Gruppe, deren ,politische‘ Kunst eigentlich nur heuchlerisch sei. Louda Ben Salah-Cazanas’ LE MONDE APRÈS NOUS (F 2021) dagegen zeichne seinen Protagonisten, einen jungen Schriftsteller mit Migrationshintergrund, als Opfer eines ausbeuterischen kapitalistischen Systems. LOS ILUSOS (E 2013) von Jonás Trueba inszeniere das Kognitariat als eine glamouröse, kosmopolitische Außenseiter-Enklave, die mit ihrer Kunst vor allem eine Ästhetisierung und Romantisierung der Existenz anstrebe und sich ihre klassenlose Utopie nur in der eigenen Filterblase zu schaffen vermöge. Allen Filmen sei das der Autofiktion innewohnende Thema der Selbstreflexion gemein – und somit eher ein Gefühl von Solipsismus als von Solidarität.
Die Diskussion des Vortrags drehte sich unter anderem darum, ob das kulturelle und soziale Kapital des Kognitariats der entscheidende Faktor ist, der es vom klassischen Proletariat abgrenzt. Dafür spräche u.a. die Gentrifizierung der alten Innenstädte durch eine linke Künstler*innen-Bohème, wie sie in LOS ILUSOS beschrieben wird. Zwar könne die ,klassische Arbeiter*innenklasse‘ heutzutage mehr Geld verdienen und einen sichereren Lebensstil führen als das Kognitariat. Doch im Gegensatz zur Fremdausbeutung sei eine freiwillig gewählte Selbstausbeutung immerhin mit sinnstiftender Arbeit verbunden und ein Privileg, dass sich nicht jeder leisten könne.
Im Abschlussvortrag untersuchte Guido Kirsten die Medialisierung der Klassenscham. Dieser negative Affekt entstehe aus dem eigenen Klassenbewusstsein, hemme aber gleichermaßen eine produktive Auseinandersetzung damit: Die Scham für den eigenen Habitus, die eigene soziale Herkunft und finanzielle Prekarität beziehe sich zwar auf strukturelle und systemische Gegebenheiten, werde aber individualisiert und selbstreflexiv wahrgenommen, anstatt kollektiv und aktivistisch verarbeitet zu werden. Somit komme es zu einer impliziten Legitimierung und Reproduktion von Hierarchien. Anhand von autosoziografischer Literatur über Armutserfahrungen zeigte Kirsten, dass Klassenscham emotionale und physiologische Reaktionen hervorrufe, welche wiederum zu schamvermeidenden Verhaltensweisen führten, die Handlungsmacht und Veränderung hemmten. Mit der Analyse des Filmes RESSOURCES HUMAINES (F/UK 1999) verdeutlichte er, dass auch die Scham über die eigene Klassenscham – bzw. über den fehlenden Klassenstolz – zum Problem werden könne. Allerdings könne die Offenheit und Vulnerabilität von Autor*innen und Filmemacher*innen über die scheinbare Unüberwindbarkeit von Klassenscham dennoch kollektivierend wirken: Schließlich aktiviere sie die Identifikation und Selbsterkenntnis der Zuschauer*innen, wodurch Mitgefühl, Solidarität und soziale Veränderung entstehen können.
Die Diskussion über den Vortrag bezog sich unter anderem darauf, ob Klassenscham inzwischen in bestimmten Milieus nicht auch umgekehrt verbreitet sei: So sei die Scham, kein Arbeiter*innenkind zu sein oder keine Marginalisierungs- und Migrationserfahrungen gemacht zu haben, bei Künstler*innen und Akademiker*innen durchaus verbreitet.
In der Abschlussdiskussion wurde der Versuch unternommen, Klasse genauer im Gefüge von Intersektionalität zu verorten, den Klassenbegriff zu verfeinern, die Utopie einer klassenlosen Gesellschaft zu formulieren und zu definieren, welche Maßnahmen die Film- und Medienwissenschaften hierzu beitragen können. Natürlich konnte die Tagung nicht abschließend klären, wie Klasse definiert werden sollte, oder woher die Unbehaglichkeit, über Klasse zu sprechen, genau kommt. Die in den Vorträgen formulierten Ansätze waren dennoch interessant. Insbesondere die Idee einer ,filmischen Commons‘, die ihre Rezipient*innen stärker in den Produktionsprozess miteinbeziehen und eine größere Diversität an Identitäten und Meinungen abbilden könnte, finde ich vielversprechend.