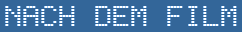SEX GOTT KRIEG
SEX GOTT KRIEG
FURY zwischen Drecksarbeit und fröhlichem Nazi-Schlachten
Es gibt nicht wenige Stimmen, die in der Auftaktsequenz von Spielbergs SAVING PRIVATE RYAN (1998) einen Quantensprung der filmischen Kriegsdarstellung vermuten. Nie zuvor, so der Tenor dieser Rezeptionslinie, sei die Zuschauerimmersion konsequenter vorangetrieben, nie zuvor der Kinosessel derart direkt inmitten des Schlachtengetümmels platziert worden. Verwechselt wird diese ausgeklügelte Strategie, die sich im Œuvre Spielbergs übrigens allerorten findet, allerdings gerne mit einem vorschnell proklamierten Realismus. Tatsächlich liegt in den überaus drastischen Darstellungen gerade deshalb eine nicht unerhebliche Ästhetisierung des Kampfgeschehens. Doch keine Aufhübschung ist hier am Werk – ganz im Gegenteil –, sondern ein sinnliches Erfahrbarmachen von Krieg.
Die kriegerische Ästhetik von David Ayers FURY (HERZ AUS STAHL, 2014) geht über den Spielberg’schen „Realismus“ einen weiteren Schritt hinaus. Gestorben wird hier – in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs, tief im deutschen Feindesgebiet – noch wahrhaftiger: von der Realität wird weniger abgezogen, dem filmischen Krieg entsprechend mehr hinzugefügt. Wenn nun also ohnehin entstellte War Bodies nochmals von Panzerketten zermatscht und oberflächlich intakte Gesichtshälften vom Boden aufgeklaubt werden, öffnet das ein neues Kapitel des Abjekten. Kompensiert wird dieses nochmals verschärft bebilderte Grauen mit einer gleichermaßen erhöhten Dosierung der Sinnstiftung. Die höchstmoralische Aufladung des längst affirmierten Good War, die bereits den Großteil von PRIVATE RYAN dominierte, wird nunmehr mit einem Konstrukt aus Liebe und Religion geleistet, das von nationalrationaler Ideologie fast gänzlich befreit scheint.
Amerikanische Flaggen sucht man in Fury vergebens. Die Abwesenheit von Politik mag für den waschechten Combat Movie wesensbildend sein. Dass hier nicht einmal an die brüderlich-soldatische Ersatz-Miniatureinheit appelliert wird, ist dennoch bemerkenswert. Nein, abgesehen von gelegentlichen posthumen Tränen erscheint der Krieg schlicht als die wahre Heimat. So begründet Brad Pitt als Befehlsgeber des titelgebenden Panzers das finale Himmelfahrtskommando. „That's war.“ Natürlich ist auch dieser Held (dessen Darsteller mit seiner „Killing Nazis“-Attitüde direkt aus INGLOURIOUS BASTERDS [2009] importiert wirkt) ein Präsenz-Traumatisierter, das muss alle Entmenschlichung hinreichend erklären. Make love and war, ruft Regisseur Ayer schon eine halbe Filmstunde zuvor zwischen die audiovisuellen Zeilen. Naja, „sie sind jung und sie leben“, wendet Pitt in gebrochenem Deutsch mit vollem Ernst ein, als sich Norman (Logan Lerman), der jüngste Neuzugang seiner Besatzung, mit dem blonden Madl (Alicia von Rittberg) ins Schlafgemach zurückzieht. Sex sells – hier eine überaus romantische Note der Kriegsgegenwart.
Wiederum einen Sinnabschnitt früher hat ‚Wardaddy‘ (Pitt) den Jüngling in der gebotenen Ruchlosigkeit des „Jobs“, nämlich im Menschentöten unterwiesen. In einer der psychisch brutalsten Szenen der jüngeren Filmgeschichte zwingt der Kommandeur den Gewissensgeplagten zu seinem Glück – denn als solch schaurig Erhabenes wird sich der Mord an einem Wertlosen (= Nazi) kurz darauf erweisen. Ideale mögen zwar friedfertig sein, sinniert der Kriegsvati, die Geschichte sei aber nun einmal voller Gewalt. Dass gemäß diesem Credo Kriegsverbrechen als moralische Folgerichtigkeiten gelten müssen, sieht auch der Grünschnabel rasch ein.
Eine wahrhaft hübsche Belohnung folgt für Norman ja ohnehin alsbald. Das amouröse Päuschen dekonstruiert Ayer im direkten Anschluss zwar pflichtschuldig per unangenehmem Gruppendisput. Damit der blutigen Drecksarbeit aber weiterhin Sinn gestiftet wird, zitiert FURY sodann ungeniert den Herrgott herbei. Ein virtuos choreografiertes Panzergefecht lässt des Erlösers Gnade unsere Helden noch unbeschadet überstehen. Was in der wenig subtil ‚Bible‘ genannten, von Shia LaBeouf gespielten Figur des bleisprühenden Missionars bereits früh angelegt ist, entlädt sich endgültig im vor Blut und Pathos triefenden Finale des Films. Da rezitiert auch der für die Frömmeleien des Untergebenen zunächst sichtlich unanfällige ‚Wardaddy‘ plötzlich textsicher aus der Heiligen Schrift, als gäbe es kein Morgen.
Und in der Tat wird das abschließende Kamikaze-Unterfangen – ein einzelnes Stahlfahrzeug gegen ein vollständiges Bataillon rhythmisch singender SS-Schergen – nur jenen einen Überlebenden zulassen, der schließlich vom Heldentod der Brüder Meldung zu machen hat. Der rekonstruierten Normandie von Spielberg setzt FURY den Norman Day entgegen, das liebliche Tête-à-Tête inmitten der Kriegswirren. Dem filmischen Fahnenschwur von PRIVATE RYAN entspricht das feierliche Gottesbekenntnis dieser späten WWII-Revision, der – anders als etwa INGLOURIOUS BASTERDS – jede Ironie fehlt. Schlachten kann auch Befriedigung und vor allem ganz viel Sinn erbringen, solange es die Richtigen trifft. Das war uns Zuschauern des Hollywood-Kinos natürlich schon längst bekannt, aber mit einem solchen Geschick ist es uns schon eine Weile nicht schmackhaft gemacht worden.