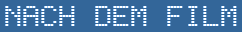Hebefiguren
Hebefiguren
Zum Sammelband Ich hatte die Zeit meines Lebens. Über den Film ‚Dirty Dancing‘ und seine Bedeutung, hrsg. von Hannah Pilarczyk, Berlin 2012.
1987 kam DIRTY DANCING in die Kinos und ich erinnere mich daran, wie meine Freundinnen und ich damals im Kindergarten die berühmte Hebefigur übten oder zumindest antäuschten: Musik an, auf die Plätze, fertig, los und dann fliegen, so wie Jennifer Grey auf der Leinwand über Patrick Swayze schwebte. Keine Frage, DIRTY DANCING hat Eindruck aufs kindliche Gemüt gemacht, die Hebefigur sich gründlich ins Gedächtnis gebrannt. Die zeitgenössische Filmkritik war weniger begeistert und besprach den Film, wenn überhaupt, eher abfällig als zuckrige Teenie-Schmonzette (Michael Althen: „ein Film fürs Gemüt“). Auch die Filmwissenschaft hat sich kaum ernsthaft mit dem Werk auseinandergesetzt.
Das ist die Lücke, die der 2012 von der Filmjournalistin Hannah Pilarczyk herausgegebene Sammelband Ich hatte die Zeit meines Lebens. Über den Film ‚Dirty Dancing‘ und seine Bedeutung schließen will. Es handelt sich dabei nicht um einen typischen filmwissenschaftlichen Sammelband. Vielmehr verbindet das kleinformatige, im Verbrecher Verlag erschienene Taschenbuch Hommage und Analyse: Es mischt Wort und Bild (zwischen den Texten stehen schwarz-weißen Bleistiftzeichnungen, die vom Berliner Zeichner Oliver Grajewski stammen), stellt Texte von Pop-Journalisten neben solche von AkademikerInnen. Insgesamt neun Beiträge, alle gut geschrieben und leicht lesbar, ergeben zusammen eine kulturwissenschaftliche Kontextualisierung und Reevaluation des populären Textes und führen dabei ganz unterschiedliche disziplinäre Perspektiven zusammen: Film- und Musikgeschichte treffen auf Jüdische Studien, Gender Studies, Tanzwissenschaft und Psychoanalyse.
Der einführende Text von Herausgeberin Pilarczyk beleuchtet die Entstehungs- und Produktionsgeschichte des Films ebenso wie seine ambivalente Rezeptionsgeschichte. Der Filmjournalist David Kleingers untersucht im Anschluss den Film (der in den 1960er Jahren spielt) als nostalgische Retro-Fiktion. Die Texte von Birgit Glombitza und Kirsten Rießelmann stellen Gender-Fragen in den Vordergrund: Glombitza versucht, Baby bzw. Darstellerin Jennifer Grey zu den ‚toughen‘ Kriegerinnen des 80er-Jahre Hollywood-Blockbuster-Kinos ins Verhältnis zu setzen, während Rießelmann den Film in eine Geschichte des weiblichen Coming-of-age-Films einordnet.
Im Anschluss folgen zwei Texte, die den jüdischen Bezügen des Films nachgehen: Caspar Battegay lenkt das Augenmerk auf den Schauplatz des Films – ein jüdisches Ferienresort in den Catskill Mountains im Staat New York – und zeichnet nach, wie der Film amerikanisch-jüdische Identität um 1960 verhandelt. Ergänzend beschreibt der spannende Text von Journalist und DJ Christoph Twickel die Begeisterung amerikanischer Juden der 50er und 60er Jahre für ‚Latin Music‘, die im Film ja eine zentrale Rolle spielt, und beschreibt die „jüdische Mambomania“ als „Liebesbeziehung zwischen einer quasi-‚weißen‘ Gruppe zur Musik einer migrantischen, in der Rassenlogik der US-Gesellschaft ‚schwarzen‘ Gruppe“ (151).
Der Musikjournalist Jan Kedves untersucht im Anschluss den Soundtrack des Films genauer, der Originalmusikstücke aus den 60ern mit in den 80ern neu produzierten mischt, und analysiert damit die „musikalische Produktion dieses merkwürdig von den Zeiten entkoppelten Nostalgie-Gefühls“ (166). Die Psychoanalytikerin Christine Kirchhoff fragt abschließend, wie es dem Film gelingt, zum „Immer-wieder-Sehen“ aufzufordern und untersucht ihn als filmische Reinszenierung des Ödipus-Komplexes.
Was aber leistet der Band für eine speziell am Tanz und an filmischen Tanzszenen interessierte Perspektive? In fast allen Beiträgen spielt das Tanzen, zumindest am Rand, eine Rolle – meist interpretiert als Ersatzhandlung für den (auf der Leinwand nicht zeigbaren) Sex. So liest Kleingers DIRTY DANCING als Beispiel dafür, wie Hollywood das „Tanzen als beste, weil zensurbefreite, Analogie zum Sex“ nutzt (76), während Glombitza von der „legendären Hebefigur“ als „Ersatz-Orgasmus in den Triebsublimierungen des Tanzfilms“ (44) spricht. Twickel versucht darüber hinaus, das im Film dargebotene ‚dirty dancing‘ tanz- und musikgeschichtlich zu verorten und diagnostiziert Nicht-Authentizität: „Baby und Johnny tanzen den Mambo – einen enthüfteten, ent-afroisierten Mambo – zu zeitgenössischen Popballaden.“ (154)
Für eine Tanz-Perspektive am aufschlussreichsten ist der herausragende Beitrag von Astrid Kusser, Historikerin. Ihr Text mit dem Titel „Ausgerechnet Wassermelonen“ untersucht die „Farbenblindheit“ (101) von DIRTY DANCING – die Verdrängung und Verschiebung schwarzer Kultur, die der Film vornimmt. Obwohl das tänzerisch-musikalische Koordinatensystem des Films, samt der sozialen Hierarchien und strikten Raumordnungen, die mit ihm einhergehen, de facto von Segregation erzähle, erspare der Film sich die offene Auseinandersetzung mit Rassismus und erzähle seine Geschichte stattdessen „als Generations- und Klassenkonflikt zwischen Weißen“ (101). Schwarze Akteure werden durch weiße ersetzt, aber das tänzerische Repertoire – Kusser identifiziert das ‚dirty dancing‘ tanzhistorisch präzise als ‚slow drag‘ –, mit dem sie kommunizieren, ist schwarz.
Man könnte DIRTY DANCING damit als Paradebeispiel dafür verstehen, was derzeit unter dem Stichwort ‚kulturelle Appropriation‘ verhandelt und kritisiert wird. Kusser aber geht es vor allem um die Ausweisung jener Stellen, an denen die Ersetzung und Verdrängung schwarzer Kultur sich als brüchig und unvollständig erweist, es geht ihr darum, die Wiederkehr des Verdrängten aufzuzeigen: Hühnchen und Wassermelone – Objekte, an denen Baby in zwei hervorgehobenen Filmszenen schwer zu tragen hat – liest Kusser als ebenso stereotype wie subversive Verweise auf afroamerikanische (Ess-)Kultur, als rudimentäre Überreste des filmischen Ersetzungsprozesses, die das Verdrängte und Ausgeschlossene doch präsent halten.
Zum anderen zeichnet Kusser nach, wie der um 1900 entstandene ‚slow drag‘ – im Deutschen gab es die Bezeichnung ‚Wackel- und Schiebetänze‘ – afrikanische Tanztechnik und Einflüsse aus europäischen Tänzen, die europäische Migranten mit nach Amerika gebracht hatten, miteinander verband. Kusser begreift dieses Tanzen als kulturelles Produkt des „Black Atlantic“ (Paul Gilroy), als Effekt wechselseitiger Faszinationen und Beeinflussungen zwischen afrikanischen, europäischen und amerikanischen Traditionen:
Die Leute näherten sich einander an, in der Sprache, im Denken, in der Philosophie. Sie erfanden eine neue Musik, eine neue Art zu Tanzen, eine neue Haltung, durch die Welt zu gehen. Ein Teil des modernen Rassismus entstand, um diese Form der Annäherung zu verhindern, zu unterbrechen oder zumindest ihr mobilisierendes Potential in ausbeutbare Bahnen zu lenken. (114)
Trotz der Verdrängung schwarzer Kultur auf der Ebene von Handlung und Figuren gebe DIRTY DANCING diesem „subversiven Potential der Geschichte des Tanzes im 20. Jahrhundert Raum“ und schmuggele sich derart „in einer Art ‚whiteface‘ in das oft konservative Genre nostalgischer Tanzfilme.“ (113)
So verortet Kusser DIRTY DANCING im Rahmen einer transatlantischen und politischen Geschichte des populären Paartanzes im 20. Jahrhundert. Hüftschwünge und Drehungen, Wassermelonen und Hühnchen können viel Bedeutung in sich bergen; hier wird sie gehoben.
Pilarczyk, Hannah (Hg.) (2012) Ich hatte die Zeit meines Lebens. Über den Film ‚Dirty Dancing‘ und seine Bedeutung. Berlin.