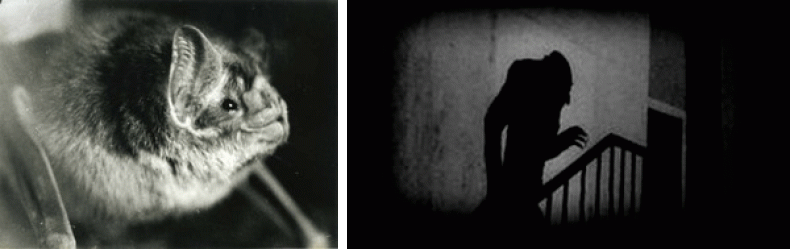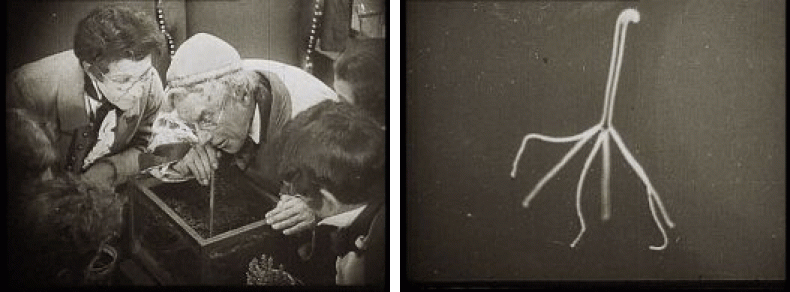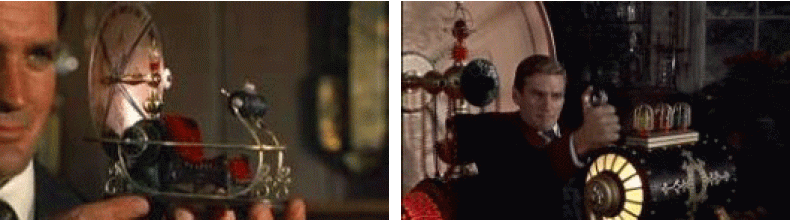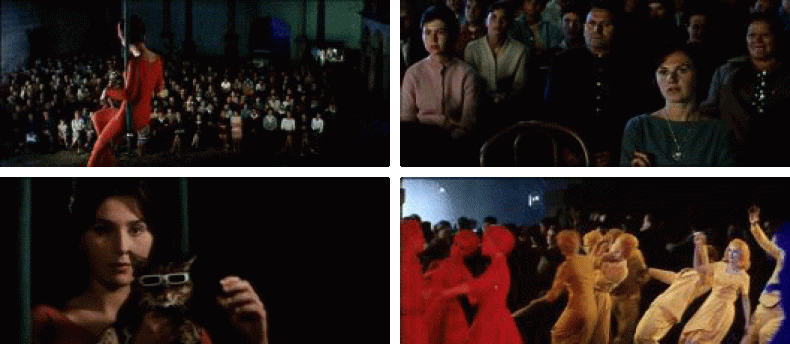Filmmuseum als Zeitmaschine
Filmmuseum als Zeitmaschine
Painlevés Sammlungen, phantastische Filmmuseen im Europäischen Science-Fiction-Kino und das Österreichische Filmmuseum
Jeder Film ist ein Medium und eine Kulturtechnik des Sammelns, die Geschichten und Geschichte produziert. Damit übernimmt der Film – jeder einzelne Film – im Grunde bereits die Aufgaben, die üblicherweise einem Museum zugeschrieben werden, nämlich eine Sammlung anzulegen, diese zu bewahren, zu erforschen – und schließlich die Sammlung auszustellen und zu vermitteln. Meine zentrale Hypothese lautet: Wenn jemand eine Filmsammlung anlegt – wie das ein Filmmuseum tut –, dann handelt es sich um eine Sammlung zweiter Ordnung, um eine Sammlung von Sammlungen. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, ob es sich um Filmrollen als Objekte oder um Film-Ereignisse handelt, die auf der Leinwand stattfinden.
Im Folgenden will ich zunächst (1.) programmatische Überlegungen zum Filmmuseum voranstellen, die das Österreichische Filmmuseum (ÖFM) als ein signifikantes Fallbeispiel heranziehen. Als Grundlage dafür dient mir die dreibändige Jubiläumsschrift: Fünfzig Jahre Österreichisches Filmmuseum 1964 | 2014. Meine Untersuchung zielt auf die Praxis des Sammelns und die Erfahrung, die man als Zuschauer in einem solchen Museum machen kann. Sie zielt aber auch auf das konkurrente Verhältnis von Film und Museum. Wie ein Film seine Sammlung anlegt, werde ich (2.) anhand von Jean Painlevés LE VAMPIRE (1939–45) skizzieren. Ich werde dazu von einem einzelnen Film ausgehen, der zudem nur neun Minuten lang ist. Dabei interessieren mich vorrangig die Produktionsseite des Films, Painlevés Praxis des Sammelns und, wie diese im Film erfahrbar wird, sowie die Bezüge auf unterschiedliche Felder von Geschichtsschreibung, die dabei eine Rolle spielen. Schließlich (3.) werde ich Beispiele des phantastischen Films – bzw. des europäischen Science-Fiction-Kinos – betrachten, die während der Gründungsphase des ÖFM bzw. in den Jahren danach entstanden sind, um damit einen utopischen Blick auf das Filmmuseum als Institution zu werfen. Die Beispiele stammen aus Frankreich (Chris Marker: LA JETÉE, 1962, Alain Resnais: JE T’AIME, JE T’AIME, 1968), aus der ehemaligen Tschechoslowakei (Vojtěch Jasný: AZ PRIJDE KOCOUR/ THE CASSANDRA CAT, 1963) und aus Deutschland (Rainer Werner Fassbinder: WELT AM DRAHT, 1973). Es geht mir um die Fragen, wie sich die Filme selbst das Verhältnis von Film und Museum vorstellen und welche Utopien vom Filmmuseum sie in ihrer Zeit entwerfen. Bei diesem Punkt wird es insbesondere um Sitzanordnungen für Zuschauer gehen, mit denen die Filme Wahrnehmungsanordnungen für ein Filmmuseum auf prägnante Weise imaginieren – ich will also auf die Geschichte des ÖFM, die eigentlich schon phantastisch genug ist, mit einer Parallel-Geschichte von phantastischen Filmmuseen antworten.
1. Was zeichnet ein Filmmuseum aus?
In den 1960er Jahren ist ein Filmmuseum etwas Utopisches, etwas im Herausbilden Begriffenes, von dem man noch nicht genau weiß, welche Form(en) es annehmen wird. Obwohl es bereits in den 1930er Jahren Gründungen von Museen und Archiven für den Film gab, so stellte sich diese Frage in den 1960er Jahren offenbar wieder neu, zumal in den Ländern, die solche Gründungen bisher versäumt hatten (s. Pauleit 2006). Das ÖFM wurde 1964 gegründet. Der Direktor des ÖFM, Alexander Horwath, beschreibt im Vorwort zum ersten Jubiläums-Band mit dem Titel „Aufbrechen“ (verfasst von Eszter Kondor) unter der Überschrift „Das gute alte Wien, das andere Österreich“, den innovativen Zug der 50 Jahre zurückliegenden Museumsgründung. Er charakterisiert diese dort als das „Kommende“, von „etwas noch nicht Vorhandenem“ (Horwath 2014a: 6–7), – und verweist gleichzeitig auf einen Text von Alexander Kluge aus dem Jahr 1964 mit dem Titel „Utopie Film“. Zu diesem Prozess des Herausbildens haben neben Kluge zahlreiche andere Theoriepositionen beigetragen, ebenso wie die vielfältigen Initiativen von Filmliebhabern und -sammlern. Aber – so meine These – auch die Filme selbst haben ihren Beitrag geleistet. Filme der 1960er Jahre haben die Frage des Filmmuseums aufs Tapet, oder besser gesagt, auf die Leinwand gebracht und zwar als phantastische Idee und Science Fiction.
Im zweiten Jubiläumsband mit dem Titel „Das Sichtbare Kino“ stellt Horwath dann im Geleitwort eine Differenz des Filmmuseums im Vergleich zu anderen Museen heraus, „Beim Film ist dieses zu bewahrende Bisherige etwas Anderes, Komplexeres als bei objektförmigen Dokumenten und Kunstwerken“ (Horwath 2014b: 13), die er im Folgenden noch weiter zuspitzt: Die Differenz zum klassischen Museum besteht aus dem Zusammenspiel von Filmrollen (als sammelbaren Objekten), Projektortechnik, (die den Film als Bewegtbild hervorbringt) und Kinoarchitektur, (mit den Elementen Leinwand und Sitze, die auf ein Publikum warten). Anekdotisch und eher am Rande erwähnt er das Erlebnis eines Besuchers, der berichtet, dass er bei einem spezifischen Film im Filmmuseum „[m]itfahren“ konnte (ebd.: 10). In welcher Art von Museum kann man tatsächlich mitfahren im konkreten Sinne einer reisenden Fortbewegung, die einem die Möglichkeit eröffnet, unterschiedliche Räume und Zeiten zu durchstreifen, folglich eine Reiseerfahrung zu machen, die durch unterschiedliche Bereiche von Geschichte und Wissen führt?
Im dritten Jubiläumsband „Kollektionen“, in dem es um die Sammlung des ÖFM geht, radikalisiert Horwath in seinem Beitrag „Das, was wir ‚besitzen‘“ diese Differenz zum klassischen Museum noch einmal, und zwar gleich im ersten Satz: „Film, wie ich ihn verstehe, kann erfahren und erinnert, nicht aber gesammelt werden [...]“ und etwas später: „das, was wir ‚mitnehmen‘ und dann ‚besitzen‘, ist hingegen der eigentliche Film: das Ereignis – die Erinnerung daran“ (Horwath 2014c: 10). Wer als Museumsdirektor Erfahrung und Erinnerung voranstellt, plädiert für den Vorrang der Vermittlung. Üblicherweise wird diese bei den zentralen Tätigkeiten eines Museums zuletzt genannt: Sammeln, Bewahren, Erforschen und dann erst kommen Ausstellen und Vermitteln. Aber der Museumsdirektor macht natürlich noch mehr, wenn er quasi gegen das Sammlungsobjekt den Begriff des Ereignisses stark macht und dabei die ganze Frage der Sammelbarkeit von Film selbst infrage stellt. Ereignis bedeutet ja von seiner Herkunft her: etwas vor Augen stellen, etwas, was sich zeigt. Im Englischen, Französischen, Lateinischen (event, évenement, eventus) bedeutet es: etwas, was herauskommt, was passiert. Aber was zeigt sich, was passiert im Kinoereignis? Ich werde an dieser Stelle keine Ereignis-Theorie des Kinos entwerfen. 1
Meine Grundidee ist zunächst viel einfacher und konzentriert sich auf den einzelnen Film als Sammlung. Es geht mir im Folgenden darum, anhand von Jean Painlevés LE VAMPIRE herauszuarbeiten, wie ein Film eine Sammlung aus Bildern, Tönen und Texten anlegt. In der Analyse dieser Konzeption liegt m.E. der Schlüssel für die Ereignishaftigkeit des Kinos.
2. LE VAMPIRE – Film als Sammlung
LE VAMPIRE gehört zum Œuvre von Jean Painlevés wissenschaftlichen Filmen, dem in der Regel eine weitere Eigenschaft zugeschrieben wird: nicht klassifizierbar. Die Nähe zum Experimentalfilm und zum Surrealismus kennzeichnet dieses Werk als Solitär der Filmgeschichte. LE VAMPIRE nimmt innerhalb des Werkes nochmals eine Sonderstellung ein – und zwar sowohl formal als auch in seinem Bezug auf Geschichte. Die formale Besonderheit besteht zunächst darin, dass dieser Film in seiner Exposition zahlreiche Ausschnitte aus anderen Werken Painlevés aufgreift und dieses Zitieren schließlich auch auf die Filmgeschichte ausweitet. Zu Beginn wird eine Reihe von seltsamen Tieren präsentiert, bis der Film sich auf seinen Star – eine Fledermaus – konzentriert und diesen unter dem lateinischen Gattungsnamen Desmodus rotundus vorstellt. Painlevé präsentiert eine Sammlung von Tieren, die Ähnlichkeit mit einem Naturhistorischen Museum bzw. einem Zoologischen Garten aufweist. Sie ist geprägt von Anschauung und erklärendem Kommentar. Die räumliche Anordnung von Museum bzw. Zoo ist im Film durch eine zeitliche Dramaturgie ersetzt.
Dann schleust Painlevé ein phantastisches Wesen in diese Sammlung hinein: den Vampir in Menschengestalt aus Murnaus Film NOSFERATU (1922). Mit diesem Sammlungsstück verlässt Painlevé die gewohnte Ordnung klassischer Tiersammlungen und ersetzt sie durch ein Prinzip des Films, konkret: die Montage eines „Fremdkörpers“. Damit stellt er nicht nur selbstreferentiell die Möglichkeiten des Films aus; er präsentiert damit auch, dass Film sammeln kann wie ein Museum – und dass er darüber hinausgeht und seine Sammlung anders anlegen kann, z.B. Objekte aus Wissenschaft und Kunst zusammenstellen und verschalten kann, wie die Vorläufer der Museen dies bereits getan haben, die Wunderkammern. Gleichzeitig erinnert Painlevé daran, dass Murnau seinerseits in den Film NOSFERATU naturwissenschaftliche Aufnahmen von Pflanzen und Tieren eingeschleust hat, z.B. den Polypen des Professor Bulwer (John Gottowt).
Painlevé hält also nicht nur eine Lehrstunde in Sachen tierkundlicher Studien ab. Wie ein Experimentalfilmer erkundet er das Medium und seine Möglichkeiten; und wie ein avantgardistischer Filmwissenschaftler vergleicht er (in seinem Film) zwei hybride Formen: den phantastischen Film Murnaus, der Aufnahmen aus wissenschaftlichen Filmen zeigt (die in Painlevés Film jedoch nicht zu sehen sind), und den wissenschaftlichen Dokumentarfilm, seinen eigenen Film über eine Fledermaus, der fiktionale, phantastische Teile enthält. Painlevés Film ist also nicht nur ein Film für den Biologie-Unterricht, sondern ein Lehrstück in Sachen Film, und zwar Film als Sammlung des Hybriden und Differenten.
Mit dem Zitat von Murnau ist aber noch eine besondere Strategie verbunden, die durch den Bezug auf Geschichte gekennzeichnet ist. Painlevé verbindet in seiner Zusammenstellung von Material zwei unterschiedliche Bereiche der Geschichtsschreibung: auf der einen Seite Naturgeschichte im Sinne der Evolution mit spezifischen Naturgesetzen, auf der anderen Seite Kulturgeschichte, Filmgeschichte und Zeitgeschichte. Diese Verbindung erfolgt auf eine spezifische Weise, die einerseits der Aufklärung verpflichtet ist und andererseits durchaus „propagandistisch“ agiert.
Die Produktionsgeschichte des Films ist komplex. Painlevé dreht seinen Film kurz vor der Kriegerklärung Frankreichs 1939 – fertiggestellt wird der Film erst 1945. Es lässt sich behaupten, dass die Schrecken des Krieges auf vielfältige Weise in LE VAMPIRE eingeschrieben sind. 2
In einem Interview berichtet Painlevé, dass er die Fledermaus aufgrund befürchteter Bombenangriffe auf Paris töten muss, da diese tatsächlich Überträger ansteckender Krankheiten war (s. Painlevé [1986] 2000). Anzumerken ist in diesem Kontext auch, dass Painlevé während der deutschen Besatzung als Persona non grata galt, Frankreich verlässt, aber inkognito zurückkehrt. 3
Die Produktion wird erst nach Ende der Nazizeit fertiggestellt. In seinem Voice-Over-Kommentar bezeichnet Painlevé in einer der letzten Einstellungen des Films einen Flügelschlag der Fledermaus als „Le salut du vampire“ und spielt damit auf den Hitlergruß an.
Naturgeschichte wird in LE VAMPIRE also mit Zeitgeschichte in Verbindung gebracht, – aber nicht im Sinne einer Naturalisierung oder Biologisierung von Historie (wie in der Blut-und-Boden-Ideologie der Nazis oder auch in vielen anderen Wissenschaftsfilmen aus der folgenden Zeit des Kalten Kriegs), sondern umgekehrt wird bei Painlevé klargestellt, dass die Naturgeschichte niemals losgelöst von politischer Zeitgeschichte betrachtet werden kann. So jedenfalls lese ich die Anspielung auf den Hitlergruß als „salut du vampire“, die die Fledermaus nicht zum Nazi macht, aber die Nazis und ihre selbstgerechte Blut-und-Boden-Ideologie sehr wohl brandmarkt als Vampirismus.
Auch die Orte der Uraufführung von LE VAMPIRE und NOSFERATU schreiben sich in das Verhältnis von Natur- und Kulturgeschichte ein: Painlevé zeigt seinen Film im Rahmen eines Filmfestivals zum wissenschaftlichen Film im Musée de l’Homme im Pariser Palais de Chaillot 1947 (s. Bazin [1947] 2000).
Die Uraufführung von NOSFERATU findet am 4. März 1922 im Marmorsaal des Berliner Zoologischen Gartens statt, ein Ort, der auch als Wirtshaus, Festsaal und Kino genutzt wurde.
Während also Painlevés „Tierfilm“ im Musée de l’Homme seinen ersten öffentlichen Auftritt hat, wählt Murnaus Produktionsgesellschaft dafür den Ort der Begegnung von Mensch und Tier, den Festsaal des Zoologischen Gartens. Beide Filme stehen also nicht nur in enger Beziehung zum Museum, weil sie selber Sammlungen präsentieren, sondern auch weil sie nicht wie üblich zuerst in einem regulären Kino, sondern im Museum bzw. im Zoologischen Garten aufgeführt wurden.
Wesentlich erscheint mir zudem, dass LE VAMPIRE nicht nur naturhistorische Objekte präsentiert im Sinne einer Klassifikation, sondern auch ein Tableau von Namen, Orten und Zeiten aufspannt und damit historisiert. Dabei entsteht ein Geflecht aus Naturgeschichte, Filmgeschichte, Musikgeschichte und Zeitgeschichte, das die unterschiedlichen Verfahren von Geschichtsschreibung zusammenbringt und überlagert. Die unterschiedlichen Bezüge auf Geschichtsschreibung will ich im Folgenden skizzenartig herausstellen:
Der Film verzeichnet ein Stück Jazzgeschichte und zwar das Duke Ellington Orchestra mit seinen Einspielungen „Echoes of the Jungle“ (1931) und „Black and Tan Fantasy“ (1927). LE VAMPIRE ist einer der ersten naturwissenschaftlichen Filme überhaupt, in denen Jazz-Musik Verwendung findet. Der Filmkritiker André Bazin erwähnt, dass das Publikum diese Filmmusik seinerzeit als Sakrileg begriff und dagegen protestierte, um dann den Film als doppelte Geschichte zu verteidigen, als zoologisches Dokument und als Fortsetzung von Murnaus blutrünstiger Mythologie – ohne allerdings den musikhistorischen Kontext weiter zu analysieren (vgl. Bazin [1947] 2000: 147). Gleichzeitig verweist Painlevé damit auf einen anderen Teil der Filmgeschichte. 1929 spielen Duke Ellington und sein Orchester in einem Kurzfilm mit, der den Titel BLACK AND TAN trägt und dessen zentrales Motiv das Musikstück „Black and Tan Fantasy“ ist.
Diese Produktion ist Teil der frühen, afroamerikanischen Filmgeschichte, der sogenannten Race-Filme, auch „midnight ramble“ genannt, die sich seit Beginn der Tonfilmzeit auf die Verbindung von Musikproduktion und Filmproduktion ausgerichtet hat. Die Filme wurden ausschließlich mit farbigen Darstellern für afroamerikanisches Publikum produziert. Obwohl von Farbigen für Farbige konzipiert, waren diese Filme häufig an die Musikindustrie angedockt und an Krimi- und „Gangsta “-Schemata ausgerichtet (s. Munby 2011). Auch wenn dies für das Melodram BLACK AND TAN nicht ganz zutrifft, denn es schildert den Tod einer Tänzerin und das Milieu des berühmten New Yorker Cotton-Clubs, so resümiert Munby dennoch, dass das afroamerikanische Kino dieser Zeit und seine farbigen Hauptdarsteller als Public Enemies und Musiker gebucht sind.
Dieser Exkurs in die afroamerikanische Filmgeschichte öffnet den Blick noch einmal anders auf die Kulturgeschichte des Jazz. Denn die Nachtclubs, in denen die Jazzmusik gespielt wurde, nannte man „Black and Tan“ (Schwarz und Braun). Sie waren eigentlich ein Ort für Farbige. Allerdings wurden diese Clubs auch von Weißen besucht, und sie machten Begegnungen zwischen farbigen und weißen Amerikanern möglich. Diese Kulturgeschichte grundiert Painlevés Inszenierung der Fledermaus als blutsaugenden Vampir und mit der von ihm selbst geprägten verbalen Hervorhebung als „Kuss des Vampirs“ spielt Painlevé in seinem Kommentar auf ein verbotenes Begehren an, das auch in der Musik seinen Ausdruck findet. Gleichzeitig überträgt er die ohnehin rassistisch geprägte Farbassoziation „Black and Tan“ auf seinen Film und erzeugt so ein Bedeutungsfeld, das den Vampirismus der Fledermaus mit der Bezeichnung der Nationalsozialisten als „braune Pest“ verbindet.
Die Musik, die Painlevé für seinen Film verwendet, verweist folglich auf unterschiedliche Geschichten, die der Jazz-Musik und die des afroamerikanischen Kinos – einschließlich ihrer Rezeption in Europa und der Ächtung dieser Musik durch die Nazis als entartete Kunst. Es handelt sich also nicht nur um einen der ersten wissenschaftlichen Filme, der Jazz-Musik verwendet (s. Painlevé [1986] 2000), sondern um einen Film, der 1945 die von den Nazis geächtete Musik feiert, in einer Art Exploitation des Dokumentarfilms. Das Charakteristische dieser Musik ist der „Wah-Wah“- oder Growling-Sound, gespielt auf der Posaune von Tricky Sam Nanton, auf der Trompete von Bubber Miley und später Cootie Williams, ein Klang, der das Duke Ellington Orchester in den 1920er Jahren berühmt machte. Der spezifische „Wah-Wah“-Sound wird durch den Einsatz eines Schalldämpfers erzeugt. Durch den veränderten Luftstrom werden auf den Blasinstrumenten keine sauberen Töne mehr gespielt – der Klang hört sich dann eher an wie eine Stimme, als ein Instrument.
Painlevé setzt die Jazz-Einspielungen wirkungsvoll für seinen Film ein: Er konfrontiert Naturgeschichte mit einer musikalischen Mythologie, dem Jungle-Sound, und unterstreicht damit die Fremdartigkeit seiner Tiersammlung auf spielerische Weise. Lehrreiche Naturanschauung wird gekreuzt mit der afroamerikanischen Boulevard-Bühne des Cotton Clubs bzw. mit den Race-Film-Screenings um Mitternacht. Aber gekreuzt werden in diesem Film nicht nur zwei unterschiedliche Schauanordnungen (Museum und Bühne bzw. Kino). Gekreuzt werden auch zwei Stimmen: die Stimme Painlevés als Voice-over, die einen erklärenden Kommentar intoniert, und die Stimmen der Blasinstrumente mit ihrem „Wah-Wah“ bilden einen wechselnden Singsang.
Die Komposition ist sehr einfach arrangiert. Spricht Painlevé, bleibt die Musik im Hintergrund. In den Sprechpausen tritt die „Wah-Wah“-Musik in den Vordergrund. Ähnlich wie auf der Bildebene, die mit sichtbaren Schwarzblenden arbeitet und ihre Gestaltung geradezu ausstellt, arbeitet Painlevé offenbar auch auf der Tonebene. Man hat den Eindruck, dass die Musik mit einem einfachen Schieberegler laut und leise gestellt wird, während sich die Stimme des Voice-overs durch stärkere Intonation gegen die Musik behaupten muss. Frieda Grafe ([1997] 2004: 181) beschreibt in einer Würdigung von Painlevés Werk dieses Voice-over in einem beiläufigen Satz: „Der von ihm selbst eingangs rhapsodisch gesprochene Kommentar, von dem man nicht genau sagen kann, ob er sich eher von der obligaten Wissenschaftssprache absetzt oder den gehobenen Ton von Kulturfilm unterstreicht, hält jedenfalls Abstand zu dem, was die Bilder zeigen“. Grafe charakterisiert die Stimme Painlevés als rhapsodisch und merkt an, dass sie Abstand hält zu den Bildern. Was Grafe mit Blick auf das isolierte Voice-over für nicht entscheidbar hält (Absetzen von oder Unterstreichen der Wissenschaftssprache), wird im Blick auf die wechselnden Stimmen von Voice-over und Blasinstrumenten zu einer musikalischen Komposition. Denn das Ton-Arrangement lässt die Autorität des Voice-overs nicht unberührt. Painlevés Stimme wird infiziert vom „Wah-Wah“, das auch wie Bla Bla klingt; das Voice-over muss sich gegen die Jazz-Stimmen behaupten, wird zu einer musikalischen Intonation des Sprechens, das sich bald zur emphatischen Predigt steigert. Die Kommentar-Stimme wird dabei selbst immer wieder von den Blasinstrumenten kommentiert, konterkariert und droht, vom Jungle-Sound verschluckt zu werden. Aus heutiger Perspektive lässt sich darin ein dekonstruktives Verfahren erkennen, welches die Autorität des klassischen Voice-overs im Dokumentarfilm schon 1945 radikal infrage stellt.
Fasst man die unterschiedlichen Bezüge noch einmal zusammen, so lässt sich Folgendes festhalten: Als Sammlung gefasst finden sich in LE VAMPIRE Objekte der Naturgeschichte (Aufnahmen Painlevés), der Filmgeschichte (Murnaus NOSFERATU, Weimarer Kino, BLACK AND TAN, afroamerikanischer Film), der Musikgeschichte (Jungle-Sound des Duke Ellington Orchestras) und der Zeitgeschichte (O-Ton von Jean Painlevé, in Gestalt eines naturwissenschaftlichen Kommentars mit seinen Anspielungen auf Mythologie und Zeitgeschichte). Angeordnet sind die Objekte in einem Tableau, das der Film selbst erzeugt. Die Ankerpunkte liegen in unterschiedlichen Wissensbereichen, zeitlich betrachtet zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und räumlich zwischen Frankreich und Deutschland, sowie zwischen Amerika und Europa.
Mit dieser Analyse wollte ich zunächst darstellen, wie ein Film eine Sammlung anlegt. Painlevés LE VAMPIRE ist ein plastisches Beispiel dafür, wie der Film heterogene Objekte versammelt und ein historisches Feld aufspannt. Plastisch ist es vor allem aufgrund der Überschaubarkeit der filmischen Mittel – und weil dieser Film eine Reflexion der Institution Kino und seiner Geschichte eröffnet und sich darin ganz als modernes Kino präsentiert. Der Fokus der Untersuchung liegt auf der kinematografischen Geschichtsproduktion, die man m.E. mit der detaillierten Analyse gerade dieses Films sehr konkret fassen kann. Was darin erfahrbar wird, ist eine Praxis, die man auch als wilde Archäologie bezeichnen kann, um ihre Differenz zu anderen Formen der Geschichtsproduktion kenntlich zu machen (s. Ebeling 2012). Charakteristisch dafür ist, dass dabei unterschiedliche Wissensbereiche in Performanz zueinander ins Verhältnis treten. Es geht also um die Aufführung von Konstellationen, die man so nirgendwo sonst, nur im Film bzw. im Kino erfahren kann.
Nimmt man diese Konzeption von Film als Sammlung ernst, dann verschiebt sich fast zwangsläufig der Aufgabenbereich eines Filmmuseums. Denn ein Museum, das Filme sammelt, die sich selbst aus Sammlungen zusammensetzen, kann diese Sammlungen kaum mehr nur wie einfache Objekte behandeln. Unter diesen Voraussetzungen tritt das Vermitteln der Sammlungen nahezu unweigerlich in den Vordergrund. Das vorrangige Ziel eines solchen Museums kann man durchaus als „Ereignis“ (Horwath 2014c: 10) deklarieren, in dem der Film als Sammlung seinen Auftritt hat, aufgeführt wird, bei dem man Mitfahren kann – ein Kino-Ereignis, das wiederum Erfahrungen und spezifische Erinnerungen an Filme erzeugt, die nur schwer planbar sind, die man als Zuschauer anschließend mitnehmen kann, um sie für sich weiter zu bearbeiten.
3. Was machen die Zuschauer im Filmmuseum?
Das moderne Kino (s. Gregor/Patalas 1965) ist u.a. gekennzeichnet von der Reflexion seiner ästhetischen Mittel, seiner Materialität, seiner Institutionen und seiner Zuschauerschaft. Christian Metz (1973) spricht von einem Kino im Inneren des Filmischen. Im Folgenden möchte ich zeigen, dass der phantastische Film bzw. das europäische Science-Fiction-Kino die Gründungsphase der europäischen Filminstitutionen in den 1960er Jahren begleitet, im Hinblick auf ihre konstitutiven Bedingungen und Möglichkeiten befragt und im Grunde Entwürfe und Modelle für ein Filmmuseum liefert, das im Entstehen begriffen ist. Meine Beispiele LA JETÉE, JE T’AIME, JE T’AIME, AZ PRIJDE KOCOUR und WELT AM DRAHT verhandeln phantastische Reisen oder Zeitreisen. Sie setzen diese Reisen aber nicht in der Tradition der phantastischen Erzählung um, sondern binden sie explizit und direkt an kinematografische Verfahren zurück, wie Fotografie, Loops, Tricktechnik/ Kolorierung, Dubbing usw. Sie präsentieren zudem spezifische Sitz- und Schauanordnungen.
Pate gestanden für diese europäischen Entwürfe hat vermutlich die MGM-Produktion THE TIME MACHINE (R: George Pal, 1960), eine Verfilmung des gleichnamigen Science-Fiction-Romans von H.G. Wells aus dem Jahr 1895. In THE TIME MACHINE wird die Zeitmaschine als Kombination aus Theatersessel und Joystick gedacht. Mit einem einfachen Mechanismus fährt man durch die Zeit – entlang einer linearen Achse. Illustriert wird die Zeitmaschine durch das Verfahren des Zeitraffers, konkret an einem Schaufenster und der wechselnden Mode, die ein Mannequin trägt. Was hier in Szene gesetzt wird, ist ein naives Verständnis von Geschichtlichkeit als Kostümfilm, der im Grunde vorgibt, eins zu eins der Wirklichkeit zu entsprechen. Siegfried Kracauer (1927) hat diese Vorstellung von Geschichte schon in den 1920er Jahren als Riesenfilm des Historismus verspottet. Die Zeitmaschine von George Pal ist allerdings mit dem Kino insofern verbunden, als man mit ihr als Zuschauer – wie in einer Theaterloge – durch allerlei Katastrophen einfach hindurch fahren kann. Im Kino ist dieser Logenplatz noch stärker geschützt, wie Miriam Hansen (1995) dies einmal treffend in einem Aufsatztitel benannt und beschrieben hat, als: „Dinosaurier sehen und nicht gefressen werden“. In THE TIME MACHINE fährt der Held kurzerhand von der Jahrhundertwende (1900) nahezu unversehrt durch drei Weltkriege einschließlich der atomaren Verseuchung nach dem dritten. Was diesem Film fehlt, ist das Paradox der Zeitreise, das häufig durch die Begegnung des Protagonisten mit sich selbst auf den Punkt gebracht wird. Die Selbstreflexion von Film und Kino beschränkt sich auf die allerdings sehr eindrückliche Demonstration von Tricktechnik und Zeitraffer.
Meine Beispiele des phantastischen Films bzw. des europäischen Science-Fiction-Kinos gehen einen Schritt weiter und sind stärker reflexiv angelegt. Ähnlich wie Jean Painlevés LE VAMPIRE legen sie Sammlungen an und pflegen Umgang mit Tieren. Sie stellen unterschiedliche, kinematografische Verfahren heraus und denken darüber nach, wie man Film und Museum zu einer Zeitmaschine umbauen kann. Sie machen Vorschläge für Sitz- und Wahrnehmungsanordnungen, die sich als phantastische Entwürfe von Filmmuseen lesen lassen. Schematisch kann man sich die kinematografischen Verfahren, Schau- und Sitzanordnungen der unterschiedlichen Filme wie folgt vorstellen:
| Verfahren | Sitze | Blicke | |
| THE TIME MACHINE | Zeitraffer | Theaterloge | omnipotenter Blick |
| LA JETÉE | Fotografie | Hängematte | Augenklappe |
| JE T’AIME, JE T‘AIME | Wiederholung | Druckkammer | Taucherbrille |
| THE CASSANDRA CAT | Tricktechnik | Bestuhlung | Brille des Katers |
| WELT AM DRAHT | Dubbing | Liegesessel | Motorradhelm |
Chris Marker: LA JETÉE
Fotografie, Hängematte, Augenklappe
Chris Marker hat in LA JETÉE eine moderne Konzeption von Filmmuseum, Zuschauer und Zeitreisen präsentiert. Marker entwirft ähnlich wie in THE TIME MACHINE das Szenario eines atomaren Krieges in der nahen Zukunft. Die Zeitreise führt den Protagonisten allerdings zurück in die Pariser Museen der Gegenwart von 1962, den Jardin des Plantes und das benachbarte Musée National d’Histoire Naturelle – mit seinen Sammlungen von ausgestopften Tieren und Skeletten. D.h. Marker verwendet kaum Kostümierung, um Historizität auszustellen, sondern verweist stattdessen auf museale Sammlungen und auf die Medien Film und Fotografie. Den musealen Sammlungen stellt Marker eine andere Schauanordnung gegenüber: das 1961 eröffnete Terminal Süd des Flughafen Orly mit seiner Besucherterrasse (Ausgangs- und Endpunkt der Filmhandlung, und Ort der Selbstbegegnung des Protagonisten). Museum und Flughafen sind die Ankerpunkte, die bei Marker das Zeitreisen begleiten. Die filmische Sammlung, die Marker präsentiert, hat einiges mit Painlevé gemeinsam: Die Bildebene zeigt einzelne Fotografien, aus denen Marker seinen Film strukturiert, z.B. die Objekte der naturhistorischen Sammlungen. Es gibt auch eine Anspielung auf die Filmgeschichte: auf Hitchcocks VERTIGO. Auch die Tonspur ist wie eine Sammlung aufgebaut, deren unterschiedliche Tonaufnahmen sich deutlich unterscheiden: Ein Voice-over (Jean Negroni) erzählt die Geschichte des Zeitreisenden und bildet eine übergeordnete Kontinuität, die die Sammlung der Fotografien ordnet. Daneben ist Musik zu hören (Kompositionen von Trevor Duncan sowie eine Aufnahme des Chors der St. Alexander-Newski-Kathedrale in Paris), zudem Geräusche und Soundeffekte (der Beat eines Herzschlags). Während der Menschenversuche im Gefangenenlager sind außerdem die flüsternden Stimmen der Experimentatoren vernehmbar, die den Fortgang der Menschenversuche und die mit ihnen einhergehenden Zeitreisen des Protagonisten kommentieren.
Markers Sammlung enthält aber zusätzliche Elemente, die sehr konkret auf ein Filmmuseum verweisen. Zunächst ist da die Besetzung von Jacques Ledoux, dem Leiter der Brüsseler Cinemathèque, der nahezu zeitgleich mit der Produktion von LA JETÉE das Brüsseler Filmmuseum eröffnet. Während also Jacques Ledoux mit seinen Architekten das Filmmuseum in Brüssel einrichtet, wird er von Marker in LA JETÉE als Leiter eines Lagers besetzt, in dem nach einem Atomkrieg Menschenversuche durchgeführt werden. Der Bezug zum Filmmuseum wird auch dadurch hergestellt, dass die Fotos aus dem „Gefangenenlager“ im Keller des Palais de Chaillot aufgenommen sind, dem Sitz des Musée de l’Homme und ab 1963 auch der Cinemathèque française. Das Still des Protagonisten aus LA JETÉE ist zu einer Ikone des Kinos geworden: ein Mann in einer Hängematte, mit Augenklappen – dieses Bild fasst Markers avantgardistische Phantasie von einem Filmmuseum zusammen. Markers Zeitreise basiert also auf einer völlig anderen Konzeption als THE TIME MACHINE. In letzterem fährt ein omnipotenter, gottähnlicher Zuschauer mit seinem Blick durch die Zeit.
Markers Zeitreise dagegen wird vom Körper des Protagonisten, von seinen Augen her abgerufen. Mithilfe von Injektionen werden Erinnerungen freigelegt. Die Hängematte ist eine Liegeposition – Schlaf, Traum, Psychoanalyse sind verwandte Verfahren. Der Protagonist wird bei Marker zum Projektor eines Kinos der Erinnerungen. Die Fotografie ist dabei ein Markenzeichen des Films, Verfremdungseffekt und Reflexion der fotografischen Materialität des Kinos. Siegfried Kracauer (1927) hatte bereits in seinem Fotografie-Aufsatz beschrieben, dass die Neuanordnung der Fotografie durch den Film eine andere Geschichte erschließt. Und genau das versucht Marker 1962: Er ordnet Fotografien neu an und dynamisiert damit das klassische Museum. Das phantastische Filmmuseum, das daraus entsteht, ist dem Fotografischen in spezifischer Weise verpflichtet: Es geht nicht um das Vorzeigen eines Besitzes in der Fotografie oder um die Aneignung einer fixierten Vergangenheit mittels Fotografie; sondern vielmehr um eine Intervention, um die Neucodierung des Fotografischen, die für Markers Filmmuseum charakteristisch ist. Dieses Filmmuseum ist eine Einrichtung zur Freilegung und Neucodierung von Erinnerung.
Alain Resnais: JE T’AIME, JE T‘AIME
Wiederholung, Druckammer, Taucherbrille
Resnais’ Film schließt unmittelbar an Marker an. Auch in JE T’AIME, JE T‘AIME geht es um Experimente am Menschen. Auch hier wird das „Versuchskaninchen“ per Injektion auf die Zeitreise geschickt. Auch in diesem Film stirbt der Protagonist am Ende. Es fehlt allerdings der direkte Bezug zum Krieg und zu den Konzentrationslagern. Der Zugang zur Vergangenheit wird von Resnais mit einer Druckkammer wie beim Tauchen in Szene gesetzt, und die Zeitreise wird mit dem Blick eines Tauchers überlagert, d.h. sie beginnt als Tauchakt: der Protagonist mit Taucherbrille beim Schnorcheln. Dann taucht er in seiner Vergangenheit auf, setzt die Taucherbrille ab und berichtet seiner Freundin, die am Strand liegt, von den Tieren, die er gesehen hat, in der Form einer Aufzählung: „Zwei Wasserschlangen, ein paar Haie, ...“. Das charakteristische kinematografische Verfahren ist in diesem Fall eine loopartige Wiederholung. Der Film kommt immer wieder auf eine Szene zurück, zeigt immer wieder das Abnehmen der Taucherbrille, lässt immer wieder den Bericht von der Unterwasserwelt hören. Im Grunde sehen wir in diesem Film Prozesse der Filmmontage, eine Vorführung der Arbeit am Schneidetisch, die das Spiel mit der Zeit ausstellt.
Dabei wird nicht immer die gleiche Aufnahme wiederholt, sondern es handelt sich um unterschiedliche Takes der gleichen Szene, die sich insbesondere in der schauspielerischen Performance minimal unterscheiden, mit der die Erfahrung einer Zeitschleife als Wiederholung inszeniert wird. Die Phantasie eines Filmmuseums besteht hier nicht nur in der Inszenierung von Druckkammer und Taucherbrille (als Bild des Übergangs in eine spezifische kinematografische Schauanordnung), sondern vor allem im Verfahren der Wiederholung, das den Film selbst explizit als Sammlung von Filmaufnahmen kennzeichnet. Resnais zeigt also explizit, dass die Wiederholung bereits auf der Ebene der Filmproduktion auf vielfache Weise in jeden einzelnen Film eingeschrieben ist. Er stellt aber gleichzeitig heraus, dass die Wiederholung ein zentrales Merkmal sowohl der Filmproduktion als auch der Rezeption darstellt. Und weiter, dass die Wiederholungen von Kinematheken (also retrospektive Filmvorführungen auf der Basis von Filmarchiven) nie einfache Rückschauen sein können, sondern eine Vervielfältigung von Zeitlichkeit initiieren, die in einer linearen Zeitordnung nicht aufgehen.
Vojtěch Jasný: THE CASSANDRA CAT
Tricktechnik/ Kolorierung, Bestuhlung, Brille des Katers
Jasnýs Film präsentiert zunächst zwei unterschiedliche Formen des Sammelns, die miteinander in Konflikt stehen: auf der einen Seite das Naturhistorische Museum mit seiner Praxis der Jagd und Tötung von Tieren, des Ausstopfens und der möglichst „lebensnahen“ Anordnung der präparierten Exponate im Schaukasten; auf der anderen Seite das Filmen von Tieren, die Kommunikation und den respektvollen Umgang mit lebenden Tieren. Austragungsort dieses Konflikts ist eine Schule. Der Schuldirektor (Jiří Sovák) ist Anhänger der Jagd und des Museums. Der Lehrer Robert, ein Anhänger des Films, arbeitet mit lebenden Tieren. Der Streit wird – hoch aktuell – um die Form des Lernens geführt. Ganz konkret geht es um Anschauung und Vermittlung.
Der Direktor sieht im ausgestopften Tier das beste Objekt zur Wissensvermittlung. Der Lehrer Robert (Vlastimil Brodský) leitet seine Form der Vermittlung hingegen vom Kino ab. Dabei verwendet er nicht den Film als Anschauungsunterricht, um Naturgesetze zu erklären. Er zielt also nicht auf die fotografische Bestätigung des Faktischen, sondern auf Initiation und Intervention, wenn er die Kinder aufruft, ihre Phantasie für die Gestaltung ihrer Zukunft einzusetzen. Dazu stellt der Lehrer eine Situation her, in der die Schüler selbst zu „Film-Projektoren“ werden und auf ein leeres Blatt Papier ihre mögliche Zukunft projizieren. Er verwendet also eine Strategie, die eine strukturelle Ähnlichkeit mit Markers Zeitreisen aufweist – allerdings ohne die Anwendung von Gewalt auskommt: Die Schüler werden auf ihrer Schulbank zu Projektoren, wie der Protagonist in LA JETÉE. Jasnýs Film ist gleichzeitig Hommage an Painlevé (die Lehrerfigur) und an Jean Vigo, auf dessen Tricktechnik aus dem Film ZÉRO DE CONDUITE in dieser Anordnung ebenfalls angespielt wird.
Jasný präsentiert aber noch ein weiteres phantastisches Element des Filmmuseums. Eine Truppe von fahrenden Schaustellern kommt in die Stadt und lädt zu einer Varieté-Vorführung ein. Das Publikum sitzt auf temporärer Bestuhlung. Hauptattraktionen sind ein Magier, der uns Tricktechnik à la Georges Méliès vorführt, und ein Kater, der einen Blick zurück auf die Zuschauer wirft. Das Tier, zuvor Gegenstand zweier unterschiedlicher Formen des Sammelns (Jagd/ respektvoller Umgang), wird im Varieté zum Akteur, der die Zuschauer entsprechend ihres wirklichen Charakters koloriert: Die Liebenden werden rot eingefärbt, die Untreuen gelb und die Lügner und Pharisäer violett. Das filmische Verfahren der Kolorierung illustriert die Intervention. Die Zuschauer verlassen ihre Stühle, geraten in Bewegung, werden selbst Teil einer Choreographie und erhalten durch den Blick des Tiers eine Färbung. Jasný präsentiert die Phantasie eines Filmmuseums als temporäres Varieté, in dem die Zuschauer in Bewegung geraten und im Blick des Tiers „Farbe bekennen“.
Rainer Werner Fassbinder: WELT AM DRAHT
Dubbing, Liegesessel, Motorradhelm
Fassbinders Film entsteht etwas später im Kontext der 1970er Jahre. Er thematisiert bereits das Computerzeitalter und simulierte Welten. Er inszeniert dazu eine hierarchische Struktur von drei Ebenen, zwei gestaffelte, simulierte Welten und darüber eine wirkliche Welt. Für die Inszenierung dieser Struktur nutzt er die Anordnung der Videoüberwachung. Dennoch schließt Fassbinder m.E. direkt an die modernen Filme des Zeitreisens an. Man kann das am Set-Design der unterschiedlichen Welten ablesen: einerseits das Labor mit Videoüberwachungsmonitoren im modernen Design, andererseits eine Hotellobby in historischem Dekor. Die Sitzanordnung für die Zeitreise ist avancierter als bei Marker, besteht aber im Grunde aus den gleichen Elementen: einer Liege und einem verdrahteten Motorradhelm. Bedeutsam scheint mir, dass die „Projektionsschaltungen“, wie sie genannt werden, mit dem Telefon zu tun haben – also mit Übertragung. Der Plot dreht sich um eine Befreiung aus der Entfremdung der Simulationen, es geht um das Erreichen der Wirklichkeit, das im Sinne eines Befreiungskampfes inszeniert wird. Und in diese Inszenierung wird auch die Painlevé’sche Betrachtung von Unterwasserwelten eingeflochten.
Die Befreiung (mit Happy End) verläuft aber nicht in den Bahnen einer Identitätspolitik von Gut und Böse, sondern zeigt sich bzw. wird wahrnehmbar als eine Politik der Differenz. Konkret wird sie mit dem Verfahren des Dubbing inszeniert, einer Montage von gefilmtem Körper und aufgezeichneter Stimme, die nicht zueinander gehören. In der Schlüsselszene am Ende des ersten Teils hört man die Stimme des Schauspielers Gottfried John als Einstein und man sieht den Körper der Figur Fritz Walfang (gespielt von Günter Lamprecht). Erst diese Hybridisierung von Körper und Stimme als kinematografische Montage führt bei Fassbinder aus der Simulation in die „Wirklichkeit“.
4. Fazit
Was hat meine phantastische Parallel-Geschichte hervorgebracht? Und was trägt sie zum Diskurs um das Filmmuseum bei? Meine zentrale Hypothese war, dass Filme selbst Sammlungen anlegen und dass ein Filmmuseen folglich das Sammeln von Sammlungen betreibt. Jetzt kann ich anfügen, ein Filmmuseum initiiert auch die Vervielfältigung von Rückschauen sowie die Neuordnung von filmischen Sammlungen in der Rückschau. Mit Painlevé lässt sich festhalten, Filme und Filmmuseen sammeln anders. Sie haben die Fähigkeit, heterogene Objekte so zu verbinden, dass Kino-Ereignisse entstehen. Kennzeichen ihrer Sammlung sind Differenz und Hybridität sowie eine multiple Geschichtsproduktion. Das moderne Kino schließlich inszeniert phantastische Filmmuseen als Zeitmaschinen. Zeitreisen sind dabei keine Inbesitznahmen von Vergangenheit und Zukunft durch die Zeitreisenden, sondern Introspektionen der Zuschauer in der Horizontalen und Projektionen ihrer Erinnerungen mithilfe von Augenklappen und Taucherbrillen (Marker, Resnais), Kolorierungen der Zuschauer im Blick einer Katze (Jasný) oder Hybridisierungen von Körpern und Stimmen durch Projektionsschaltungen (Fassbinder).
Der vielleicht überraschende Bezugspunkt dieser Phantasien ist das lebende Tier. In LA JETÉE sind es die ausgestopften Tiere des Musée National d’Histoire Naturelle, die in den Fotografien des Films ein zweites Mal konserviert sind und so auf das lebende Tier verweisen. In JE T’AIME, JE T‘AIME ist es einerseits eine Maus, die zusammen mit dem Protagonisten auf Zeitreise geht, und andererseits sind es die Tiere der Unterwasserwelt, die nur mehr im Sprechakt auftauchen. In THE CASSANDRA CAT sind es der erlegte Storch, die Tiere des Lehrers und der magische Kater und in Fassbinders WELT AM DRAHT schließlich die Goldfische im Aquarium. Dieser Bezug auf das Tier korrespondiert vermutlich mit einer politischen Ausrichtung der (phantastischen) Filmmuseen an der Erfahrung von Differenz. Er ist zudem Teil der Bearbeitung und Aufarbeitung der Geschichte des Kinos nach 1945, die wiederum selbst Teil kolonialer und anderer Formen der Ausbeutung und Aneignung gewesen ist.
P.S.
Wer nun danach fragt, wie diese Überlegungen ganz konkret mit der Sammlung des ÖFM verbunden sind, oder danach, wie die österreichische Geschichte des Films praktisch in meine kleine Sammlung von Filmen hineinspielt, dem würde ich vermutlich antworten, dass der erste österreichische Film, den ich beim Weiterschreiben in diese Sammlung aufnehmen würde, Peter Kubelkas UNSERE AFRIKAREISE (1966) wäre. Denn dieser untersucht ebenfalls eine spezifische Form des Reisens, er greift die koloniale Ausbeutung des Tiers auf, reflektiert die Aneignung von Geschichte. Aber das ist ein anderes Kapitel.
- 1Siehe hierzu Altman (1992), Nessel (2008).
- 2Ähnliches gilt für Murnaus Film NOSFERATU.
- 3Erwähnen muss man auch den Bezug zu Louis Feuillades LES VAMPIRES (1915), eine frühe Gangsterserie, die die Ängste der Bürger während des Ersten Weltkriegs auf die Leinwand brachte, denn Painlevé war nicht nur Dokumentarfilmer, sondern zudem bekennender Surrealist, und die Surrealisten waren begeisterte Fans der Feuillade-Sequels.
Altman, Rick (1992): General Introduction. Cinema as Event, in: Ders. (Hg.): Sound Theory / Sound Practice, New York: Routledge, S. 1–14.
Bazin, André (2000): Science Film. Accidental Beauty [1947], in: Masaki Bellows, Andy / McDougall, Marina (Hg.): Science is Fiction. The Films of Jean Painlevé, San Francisco: Brico Press, S. 145–147.
Ebeling, Knut (2012): Wilde Archäologien I. Theorien materieller Kultur von Kant bis Kittler, Berlin: Kulturverl. Kadmos.
Grafe, Frieda (2004): Surreal und unter Wasser. Ein Wilderer – Jean Painlevé. 1902 bis 1989 (Vortrag in der Kunsthochschule Hamburg 29.1.1997), in: Dies.: Film / Geschichte. Wie Film Geschichte anders schreibt, Berlin: Brinkmann & Bose, S. 180–193.
Gregor, Ulrich / Patalas, Enno (1965): Geschichte des modernen Films, Gütersloh: S. Mohn.
Hansen, Miriam (1995): Dinosaurier sehen und nicht gefressen werden. Kino als Ort der Gewalt-Wahrnehmung bei Benjamin, Kracauer und Spielberg, in: Koch, Gertrud (Hg.): Auge und Affekt. Wahrnehmung und Interaktion, Frankfurt a.M.: Fischer, S. 249–271.
Horwath, Alexander (2014a): Das gute alte Wien, das andere Österreich (Vorwort), in: Kondor, Eszter (Hg.): Aufbrechen. Die Gründung des Österreichischen Filmmuseums, Wien: ÖFM/ Synema, S. 5–9.
Horwath, Alexander (2014b): Zum Geleit, in: Ders. (Hg.): Das Sichtbare Kino. Fünfzig Jahre Filmmuseum. Texte , Bilder, Dokumente, Wien: ÖFM/ Synema, S. 8–14.
Horwath, Alexander (2014c): Das, was wir „besitzen“, in: Ders. / Caneppele, Paolo (Hg.): Kollektionen. Fünfzig Objekte. Filmgeschichten aus der Sammlung des Österreichischen Filmmuseums, Wien: ÖFM/ Synema, S. 10–13.
Kracauer, Siegfried (1927): Die Photographie, in: Frankfurter Zeitung, 28. Oktober 1927.
Metz, Christian (1973): Sprache und Film, Frankfurt am Main: Athenäum.
Munby, Jonathan (2011): Baad Cinema. Die Gangster Connection im afroamerikanischen Film, in: Winfried Pauleit et al. (Hg.): Public Enemies. Film zwischen Identitätsbildung und Kontrolle, Berlin: Bertz + Fischer, S. 37–50.
Nessel, Sabine (2008): Kino und Ereignis. Das Kinematografische zwischen Text und Körper, Berlin: Vorwerk.
Painlevé, Jean (2000): Jean Painlevé Reveals the Invisible [1986], in: Masaki Bellows, Andy / McDougall, Marina (Hg.): Science is Fiction. The Films of Jean Painlevé, San Francisco: Brico Press, S. 170–179.
Pauleit, Winfried (2006): Kino / Museum. Film als Sammlungsobjekt oder Film als Verbindung von Archiv und Leben, in: Ders. / Kittlausz, Viktor (Hg.): Kunst – Museum – Kontexte. Perspektiven der Kunst- und Kulturvermittlung, Bielefeld: Transcript, S. 113–135.