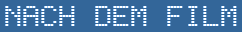Jafar Panahi: Ein Leben im Protest
Jafar Panahi: Ein Leben im Protest
Autofiktion als Kunstgriff des politischen Widerstands im iranischen Kino
Der iranische Regisseur Jafar Panahi gehört zu einer Handvoll Regisseuren, die bei allen der drei größten europäischen Filmfestivals die Hauptpreise gewonnen haben. Sein Film DAYEREH/DER KREIS (IRN/ITA/SUI 2000) gewann den Goldenen Löwen in Venedig, TAXI/TAXI TEHERAN (IRN 2015) erhielt den Goldenen Bären in Berlin und dieses Jahr erhielt Panahi in Cannes die Goldene Palme für seinen neuesten Film YEK TASADOFE SADE/EIN EINFACHER UNFALL (IRN/FRA/LUX 2025). Dieser Hattrick ist sonst nur Henri-Georges Clouzot, Robert Altman und Michelangelo Antonioni gelungen.1 Die Preise erhielt Panahi im Laufe einer langanhaltenden Karriere, die er seiner unnachgiebigen Widerstandsfähigkeit verdankt, denn das Regime der Islamischen Republik Iran hatte dem regimekritischen Regisseur 2010 bereits ein Berufsverbot ausgesprochen: wegen „Propaganda gegen das Regime“ [Übersetzung des Verfassers] (Kamali Dehghan 2010). Wäre er diesem nachgegangen, hätte er weder die Palme noch den Bären gewonnen – und die Kinolandschaft wäre um einiges ärmer geworden!
Dass Panahi Filme weiterdrehen konnte, verdankt er einer geschickten Geheimhaltung seiner Projekte vor dem Regime und kreativen Ansätzen, seine Filme umzusetzen: ob IN FILM NIST/DIES IST KEIN FILM (IRN 2011), den er abgeschottet in seiner Wohnung drehte, oder TAXI TEHERAN, der komplett aus einem Taxi heraus gedreht wurde, oder auch KHERS NIST/KEINE BÄREN (IRN 2021), der an der türkischen Grenze in einem kleinen Dorf gedreht wurde. Das Filmmaterial dann stets zügig außer Land gebracht, konnten seine Filme auch in Zeiten des Berufsverbots, eines Interview- und Ausreiseverbots fertiggestellt und bei den großen Festivals weiterhin gezeigt werden, nur eben ohne Panahis Anwesenheit.2
In dieser Zeit sorgte Panahi auf internationaler Ebene für viel Aufmerksamkeit, denn er legte mit seinen Filmen den Finger auf die Wunde, auf seine eigene Situation, und stellte damit nicht nur die Methoden der Islamischen Republik auf einen Präsentierteller, sondern konnte auch eine Art internationale Lobby schaffen, die ihm den Rücken stärkte. Als er 2010 und 2023 während seiner Verhaftungen im berühmt-berüchtigten Evin-Gefängnis in den Hungerstreik ging, setzten sich auf internationaler Ebene viele namhafte Kunst- und Medienschaffende für Panahis Freilassung ein – beide Male mit Erfolg (vgl. Tagesspiegel 2010; vgl. Spiegel 2023).3 Indem er seine eigene Situation als vom Regime isolierter Künstler in der Schaffenskrise, aber voller Kreativität und Schaffensdrang, in den Fokus stellte, nutzte er die künstlerische Praxis der Autofiktion, um sich in einem Zeitgeist, einem politischen System und einem gesellschaftlichen Kontext zu verorten und damit nicht nur vielen Betroffenen aus der Seele zu sprechen, sondern auch internationale Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Autotheory und Autofiction4
Die Autotheorie beruht auf dem Theoretisieren und Philosophieren aus der jeweiligen Situation heraus, in der man sich befindet, und schöpft aus dem eigenen Körper, den eigenen Erfahrungen, Anekdoten, Vorurteilen, Beziehungen und Gefühlen, um kritisch über Themen wie Ontologie, Epistemologie, Politik, Sexualität oder Kunst zu reflektieren. [Übersetzung des Verfassers] (Fournier 2021: 68)
Die Autotheory ist eine künstlerische Methode in Ich-bezogenen Formaten wie Autobiografien, Tagebücher oder Essays, die auf persönliche Erfahrungen, Vorstellungen und Erlebnisse setzt. Ziel ist, sich von dominanten gesellschaftlichen Strukturen zu emanzipieren – im westlichen Kontext oftmals als feministische Praxis vor allem vom Patriarchat (vgl. Freeman/Auburn 2022: 1–3). Durch das Einbringen subjektiver Perspektiven entsteht eine neue, soziokulturell fundierte Erzählweise. Seit den 1960er- und 1970er-Jahren etablierte sich diese Praxis zunehmend als Mittel, Kunst mit gesellschaftspolitischen und zeitgenössischen Fragestellungen zusammenzubringen. Bei der Autotheory rücken sozialgesellschaftliche Probleme und marginalisierte Narrative in den Fokus, die zuvor medial kaum sichtbar waren (vgl. Kitnick 2018: 45–47).5
Das Teilen persönlicher Erfahrungen und das gleichzeitige Objektwerden der kunstschaffenden Person sollen eine intimere Beziehung zwischen Autor*in und Rezipient*in ermöglichen und damit Identifikationspotenziale verstärken (vgl. ebd.: 51). In engem Zusammenhang steht die sogenannte Autofiction – gewissermaßen der „Cousin“ der Autotheory (Wiegman 2020: 7). Hier verschwimmt die Linie zwischen autobiografischen und fiktionalen Elementen. Neben den künstlerischen Werken selbst spielen dabei auch die öffentliche Wahrnehmung und Selbstdarstellung der Autor*innen eine Rolle, etwa durch Boulevardpresse, Gerüchte, mediale Auftritte, Social Media oder andere Formen der öffentlichen Inszenierung.
Die Autofiktion hat Tradition im iranischen Kino
Während Autofiktion in Literatur und Kunst vielfach als Praxis Verwendung findet, ist es in der Filmlandschaft eher rar gesät, dass die Filmemacher selbst vor die Kamera treten und sich selbst spielen. Ein besonders nennenswertes Beispiel ist neben Jafar Panahi der italienische Regisseur Nanni Moretti. Doch wird ein tieferer Blick in die Iranian New Waves, insbesondere die zweite Welle, angeführt von Abbas Kiarostami, geworfen, ist zu erkennen, dass die Autofiktion Tradition im iranischen Kino hat. So fand Panahis erster autofiktionaler Auftritt gar in einem Film von Abbas Kiarostami statt.
In ZIRE DARAKHATAN ZEYTON/QUER DURCH DEN OLIVENHAIN (IRN 1994) erzählt Kiarostami die Geschichte davon, wie er sich nach einem schweren Erdbeben auf die Suche nach zwei Kinderdarstellern macht, die in der Gegend leben und mit denen der Filmemacher bereits zusammengearbeitet hat. Er möchte sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Zu Beginn des Films gibt es eine Szene, in der Schauspieler Mohamad Ali Keshavarz zum Publikum spricht und erklärt, dass er den Regisseur spielen werde, da dieser nicht vor die Kamera treten wolle. Hier finden sich Anleihen einer Autofiktion, wenngleich Kiarostami selbst nicht vor die Kamera tritt. Die Grenzen verschwimmen in späteren Szenen, in denen andere – in diesem Fall: echte – Crew-Mitglieder im Film als sie selbst zu sehen sind, darunter Regieassistenz Jafar Panahi.
Kiarostami lässt die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen. Und er ist nicht der einzige Regisseur seiner Zeit. Auch New-Wave-Regisseur Mohsen Makhmalbaf, der mit Kiarostami zu den Vorreitern der zweiten Neuen Welle in den 1980er-Jahren gehörte (vgl. Cinema Waves Blog o.J.), vermischte inszenierte Szenen mit dokumentarischen und spielte dabei oftmals selbst mit. Als Beispiel dient hier NUN O GOLDUN/BROT UND BLUMENTOPF (IRN/FRA 1996). In diesem Film spielt Makhmalbaf einen Regisseur, der von einem Polizisten gebeten wird, einen Film über einen Vorfall zu drehen, der sich zwischen den beiden in ihrer Kindheit ereignete. Der Film hat somit zwei Ebenen: Makhmalbafs Geschichte, den Film zu drehen, und die Szenen, die von Makhalbaf in der inneren Logik des Films inszeniert werden. Es zieht sich weiter durch Makhmalbafs Filmografie, selbst aufzutauchen und dokumentarische Aspekte mit fiktiven zu vermischen. Zwischen Makhmalbaf und Kiarostami gibt es auch filmische Dialoge, wenn es so formuliert werden darf. So spielt Makhmalbaf sich selbst in NEMAYE NAZDIK/CLOSE-UP (IRN/FRA 1990).
Es entsteht ein Netz aus Dialogen zwischen den Filmemachern, in dem sie in den Filmen der jeweils anderen auftauchen und in einen weiteren Dialog mit dem Publikum treten. Die Dynamik, die dadurch entsteht, ist eine deutlich intimere zwischen Filmemacher*innen und Zuschauer*innen, die sich durch das iranische Kino zieht. Die Filmemacher haben somit einen ganz anderen Zugang zu ihrem Publikum und wenn Panahi 2011 in DIES IST KEIN FILM erstmals im Berufsverbot einen Film dreht und vor die Kamera tritt, ist bereits eine Vertrautheit mit seinem Publikum vorhanden.6
Im System verortet, aber auf sich gestellt
In seinem Kurzfilm OU EN ETES-VOUS JAFAR PANAHI?/WHERE ARE YOU, JAFAR PANAHI? (IRN/FRA 2016) erklärt Panahi, warum er in der Zeit seines Berufsverbots Filme über sich selbst und nur sich selbst dreht:
Woher nimmt ein Regisseur, der sich mit sozialen Themen beschäftigt, diese? Was ist der Ursprung seiner Geschichten? Die Gesellschaft, in der er lebt. [...] Was war die Quelle für meine früheren Filme? Die Gesellschaft. Es hat sich auf der Straße abgespielt. Ich habe nie einen Film in Innenräumen gedreht. Ich habe nie in Häusern gefilmt. Aber was ist die aktuelle Situation? Die aktuelle Situation bedeutet, dass ich von der Gesellschaft abgeschnitten bin. Ich werde in eine Ecke gestellt. Und jetzt, da ich in meiner Ecke stehe, worüber kann ich reden? Offensichtlich über meine eigene Geschichte. Früher waren die Menschen, die Menschen auf der Straße, das Hauptthema. Heute bin ich es, das Hauptthema. Ich bin gezwungen, vor meiner Kamera zu bleiben und anstelle der anderen zu handeln. Meine eigene Geschichte zu erzählen. Das liegt an der Situation. Ich habe diese drei Filme nicht gemacht. Sie sind eine Folge der Situation, in der ich mich befinde. Diese drei Filme wurden von denen gemacht, die mich in diese Situation gebracht haben. Welche anderen Filme könnte ich sonst machen? [Übersetzung des Verfassers] (2018: 11‘41‘‘)
Panahi verortet sich damit im Sinne der Autotheory im System und macht auf Strukturen und marginalisierte Narrative aufmerksam, die vom Regime unsichtbar gemacht werden. Was dabei jedoch von der in der Kunstpraxis üblichen Autotheory abweicht, ist, dass Panahi in einer Ausnahmesituation ist. Der Identifikationscharakter fehlt, vor allem beim Publikum, das seine Filme ansteuern: Panahis Filme laufen nämlich hauptsächlich auf europäischen Filmfestivals. Das Publikum lebt nicht im Iran und ist wahrscheinlich über die meisten Hinrichtungen des Regimes, die Strenge der Berufsverbote und die nicht vorhandene Kunst- und Pressefreiheit nicht im Bilde oder kann diese im besten Falle auf einer intellektuellen Ebene begreifen, weniger auf einer emotionalen.
Im Iran selbst sind Teile von Panahis Filmografie verboten. Wer sich im Iran Filme von Panahi anschauen möchte, muss auf illegale Wege zurückgreifen. Das bedeutet, dass das iranische Publikum sogar noch einen Mehraufwand hat, um mit Panahis Kunst in Berührung zu kommen, wodurch der Dialogcharakter zwischen Filmemacher und Publikum verstärkt wird. Das Publikum muss aktiv dazu beitragen, einen Panahi-Film zu schauen.
Während dieses drastische Vorgehen des Regimes ein europäisches Publikum schockiert, ist es im Iran im Grunde gängige Praxis. Auch wenn die meisten Menschen dort nicht als Regisseur*innen aktiv sind, so sind viele Menschen dort durch das Regime eingeschränkt, wodurch eben doch ein Identifikationscharakter vorzufinden ist. So entsteht eine kollektive Praxis gegen das Regime und ein Dialog zwischen den Menschen, die von diesen Strukturen unterdrückt werden!
Panahi selbst wird im medialen Diskurs für seine regimekritischen Filme als mutig bezeichnet (vgl. Rist 2009; vgl. Azizi 2025; vgl. Mohamadi 2025). Während der Pressekonferenz in Cannes 2025 zu EIN EINFACHER UNFALL, die erste, die er seit seinem Berufsverbot besuchen durfte, betonte er immer wieder, dass er nicht mutiger sei als jede andere Person im Iran, die sich auf ihre Weise gegen das Regime stelle. Besondere Erwähnung finden die Frauen, die während der Frau-Leben-Freiheit-Proteste 2022 auf die Straßen gingen und bis heute ohne Kopftuch im stillen, aber klar sichtbaren Protest jeden Tag ihre Freiheit aufs Spiel setzen (vgl. Girish 2025). Während im Iran jedoch vom Regime gesteuerte Internetausfälle dafür sorgen, dass der Protestalltag im Inland nicht nach außen gelangt, hat Panahi als international gefeierter Filmemacher die Möglichkeit, seine Reichweite zu nutzen.
So ist Jafar Panahis Offscreen-Persona in Bezug auf sein filmisches Schaffen von besonderer Wichtigkeit. Dass Panahi seinen Film DIES IST KEIN FILM auf einer Festplatte, die in einem Kuchen versteckt wurde, aus dem Land geschmuggelt hat (vgl. Campbell 2024), verrät viel über seinen Einfallsreichtum und die beinahe comichaften Methoden, die er nutzen muss, um sich dem Regime entgegenzustellen. In seinen Filmen spiegelt sich dieser Humor, den Panahi hat, der ihm wahrscheinlich hilft, stetig weiter gegen das Regime anzukämpfen, wider. Im Vergleich zu anderen zeitgenössischen iranischen Filmemachern wie Asghar Farhadi, der philosophisch, nachdenklich und intensiv in seiner Inszenierung ist, oder Mohammad Rasoulof, zynisch und knallhart in seiner Symbolik, verliert Panahi nie seinen Humor. Seine Filme bringen eine Leichtigkeit mit sich, eine Verspieltheit.
Humor als Eckpfeiler gegen Hinrichtungen und Unterdrückung
Wer sich mit Jafar Panahis Frühwerk auseinandergesetzt hat, weiß, dass es auch BADKONAKE SEFID/DER WEISSE BALLON (IRN 1995), AYNEH/DER SPIEGEL (IRN 1997) und OFFSIDE (IRN 2006) nicht an Humor mangelt. Als herausragendes Beispiel dient hier OFFSIDE. Der Film dreht sich um eine Gruppe fußballbegeisterter Frauen, die sich ins Stadion schleichen wollen. Als Frauen ist ihnen der Besuch untersagt, also verkleiden sie sich als Männer. Ohne Drehgenehmigung im Guerilla-Stil ließ Panahi seine Schauspielerinnen auf das Stadion los und filmte das Geschehen (vgl. Ford 2019). Eine dramatische Geschichte über die Unterdrückung der Frauen ist OFFSIDE jedoch nicht. Stattdessen gibt es philosophische Gespräche, eingetaucht in humorvollen Streitereien mit den Sicherheitspersonen des Stadions und der Polizei. Dieses Geschick, ernste Themen humorvoll zu verpacken, wird schließlich in seinen autofiktionalen Filmen seine große Stärke. Die Idee, einen Film ausschließlich in einem Taxi spielen zu lassen, in dem Panahi selbst mit verschiedenen Passagier*innen in Kontakt kommt, könnte zäh und ernst sein, wenn Panahi sich nur über seine Situation beschweren würde. Stattdessen lässt er uns seinen Ärger in TAXI TEHERAN nicht spüren und verfängt sich eher in humorvollen Diskussionen, in denen er seine Situation darlegt und mit Humor nimmt. Am Ende des Films gibt es eine Szene, in der ein Einbrecher die Sicherheitskamera des Taxis, auf die der Film aufgenommen wurde, klauen möchte. Er stellt fest, dass es keine SD-Karte gibt. Es wurde die ganze Zeit über nicht gefilmt, wenngleich wir als Zuschauende natürlich die gesamte Zeit über einen aufgezeichneten Film geschaut haben. Ein humorvolles Augenzwinkern an das Regime nach dem Motto: ‚Nein, wir drehen hier doch gar keinen Film!‘
Humorvolle Filme, ernste Ansprachen
Zum Abschluss wird noch einmal der Aspekt der medialen Persönlichkeit genauer untersucht: Wie geht der Mythos Jafar Panahi über die Leinwand hinaus? Es hat seinen Grund, dass das Regime dem Regisseur nicht nur ein Berufsverbot und eine Gefängnisstrafe aufgedrückt hat, sondern auch ein Ausreiseverbot und ein Interviewverbot. Stets laut und klar in seiner Positionierung gegen das Regime, weiß Panahi, seine Stimme auch abseits seiner Filme zu nutzen. Durch die Maßnahmen gegen ihn, fehlt es ihm an Möglichkeiten, mediale Präsenz in einem Land zu zeigen, das ihn unsichtbar machen will, und ohne auszureisen, wird es auch schwierig, im Ausland Präsenz zu zeigen. Doch die Geschichten, wie er seine Filme in Kuchen aus dem Land schmuggelt, der Fakt, dass internationale Filmemacher Petitionen unterschreiben, um auf Jafar Panahis Gefängnisaufenthalt und einen damit verbundenen Hungerstreik aufmerksam zu machen, hallen nach.
Er muss den Ernst der Lage in seinen Filmen nicht in einem bitterernsten Tonfall thematisieren, da seine Geschichte so schon ernst genug ist. Als klarer Bruch mit seinen Filmen ist seine Art, in die Öffentlichkeit zu treten, nicht unbedingt von Humor geprägt. Wie bei den 78. Filmfestspielen von Cannes zu sehen, trägt er bei den Konferenzen meistens Sonnenbrillen – sodass seine Augen nicht klar sichtbar sind. Er spricht ruhig und unaufgeregt, bedacht, und dass er lacht, ist beinahe schon eine Rarität.7 Der Moment seines Sieges der Goldenen Palme 2025 ist beinahe schon Sinnbild seiner Medienpersona. Als er gewinnt, scheint diese ruhige und ernste Fassade für einen kurzen Moment zu verschwinden, wenn seine Emotionen kurz aus ihm herausbrechen, ehe er wieder in seinen Medienpersonamodus wechselt und auf der Bühne eine Rede für die Freiheit hält – und sich im Anschluss an die Zeremonie den Fragen der Presse stellt.
In seiner ausgelassenen Stimmung – mehr noch als während der Pressekonferenz einige Tage zuvor – bleibt er ein mahnendes Beispiel für einen Mann, der viel gesehen und erlebt, seinen Humor dabei aber nie verloren hat. Diesen zeigt er vor allem in seinen Filmen, weil Filme eben Filme sind und und die Realität vielleicht doch noch eine Spur grausamer ist. Die trotz ernsten Thematiken humorvollen Filme Panahis stehen somit in einem Spannungsfeld mit Panahis öffentlichem Auftreten. In Wechselwirkung färben Auftreten und Werk aufeinander ab und schaffen so Narrative, die über die Filme hinaus wirken und Panahis Gesamtwerk eine Dringlichkeit verleihen, welche die Filme in seiner Filmografie zu einem Geflecht zusammensetzt, das über die einzelnen Filme hinausgeht.
- 1
Die Preise erhielten sie für folgende Filme: Clouzot gewann in Berlin und Cannes für denselben Film, LE SALAIRE DE LA PEUR/LOHN DER ANGST (FRA/ITA 1953). In Venedig erhielt er den Goldenen Löwen für MANON (FRA 1949) Robert Altman gewann für SHORT CUTS (USA 1993) in Venedig, für MASH (USA 1970) in Cannes und für BUFFALO BILL AND THE INDIANS, OR SITTING BULL‘S HISTORY LESSON/BUFFALO BILL UND DIE INDIANER (USA 1976) in Berlin. Antonioni erhielt für IL DESERTO ROSSO/DIE ROTE WÜSTE (ITA 1964) den Goldenen Löwen in Venedig, die Goldene Palme von Cannes erhielt er für BLOW UP (GB/ITA 1967) und in Berlin gab es den Goldenen Bären für LA NOTTE/DIE NACHT (ITA/FRA 1961). Auch Jean-Luc Godard konnte die Preise gewinnen, seine Goldene Palme war dabei allerdings eine erstmals verliehene Palme d‘Or Spécial, eine irreguläre Goldene Palme.
- 2
Jafar Panahi hat während seines Berufsverbots fünf Langfilme gedreht:
DIES IST KEIN FILM
PARDÉ (IRN 2013)
TAXI TEHERAN
SE ROKH/DREI GESICHTER (IRN 2018)
KEINE BÄREN
- 3
Das Evin-Gefängnis ist besonders bekannt für die Härte, mit der dort gegen Gefangene vorgegangen wird. Außerdem sind dort viele politische Gefangene wie eben Panahi. Auch Mohammad Rasoulof und andere Filmschaffende wurden im Teheraner Evin-Gefängnis inhaftiert. Panahi wurde gemeinsam mit Rasoulof 2010 verhaftet, nachdem den beiden Regisseuren vorgeworfen wurde, sie würden einen Film über die Grüne Revolution 2009 drehen, der propagandistisch gegen das Regime sei. Panahi wurde nach kurzer Haft in 2010 zu 20 Jahren Berufsverbot verurteilt und zu sechs Jahren im Gefängnis. Die Gefängnisstrafe trat er 2022 an, wurde jedoch nach gut einem halben Jahr nach Zahlung einer Kaution und internationalen Protesten, nachdem Panahi in einen Hungerstreik ging, wieder freigelassen. Sein Berufsverbot ist seitdem auch aufgehoben (vgl. Tagesspiegel 2010; vgl. Spiegel 2023).
- 4
In meinem Text „Die vielen Gesichter des Nanni Moretti und das Erschaffen eines autofiktiven Selbst“ auf Nach dem Film habe ich ebenfalls über die Autofiktion geschrieben. Einige Formulierungen und Inhalte könnten sich daher ähneln.
- 5
Als gutes Beispiel dient hier DENSE MOMENTS von Gregg Bordowitz. An AIDS erkrankt, zeigt er seinen Kampf mit der Krankheit offen, um abseits vom medialen Diskurs echte Erfahrungen zu zeigen (vgl. Bordowitz 2004: 130).
- 6
An dieser Stelle soll eingeworfen werden, dass Panahi bereits vor seinem Berufsverbot autofiktionale Aspekte in seine Filme einbrachte. In DER SPIEGEL geht es um ein junges Mädchen, das von der Schule nachhause möchte, aber auf sich gestellt ist. Ungefähr in der Mitte des Films bricht die Schauspielerin mit ihrer Rolle und äußert, dass sie keine Lust mehr habe, den Film zu drehen. Sie möchte nachhause gehen. Vor laufender Kamera kommt Panahi ins Bild und möchte sie überzeugen, weiterhin Teil des Films zu bleiben. Im Geheimen (?) filmt er dann die Schauspielerin auf ihrem Weg nachhause.
- 7
Dies sind eigene Beobachtungen, die ich während der 78. Filmfestspiele von Cannes gemacht habe. Die Einschätzungen erfolgen nicht nur durchs Beobachten, sondern auch durch Interaktionen mit dem Regisseur. Während der Pressekonferenz habe ich selbst eine Frage gestellt und im Anschluss kurz mit Herrn Panahi gesprochen.
Azizi, Arash (2025) A Tale of Two Films as Iran’s Panahi Wins Cannes Top Award, in: IranWire, 25.05.2025. URL: https://iranwire.com/en/society/141481-a-tale-of-two-films-as-irans-panahi-wins-cannes-top-award/ – aufgerufen am 23.06.2025.
Bordowitz, Gregg (2004) Dense Moments, in: Bordowitz, Gregg/Meyer, James Sampson (Hg.) The AIDS Crisis Is Ridiculous and Other Writings, 1986-2003. Cambridge: MIT Press. S. 130.
Campbell, Scott (2024) ‘This Is Not a Film’: the movie smuggled out of Iran inside a cake, in: Far Out, 18.07.2024. URL: https://faroutmagazine.co.uk/movie-smuggled-out-of-iran-inside-a-cake/ – aufgerufen am 23.06.2025.
Ford, Jack (2019) Escape From Tomorrow: Review, in: BRWC, 05.04.2019. URL: https://battleroyalewithcheese.com/2019/04/review-escape-from-tomorrow/ – aufgerufen am 23.06.2025.
Fournier, Lauren (2001) Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing, and Criticism. Cambridge: MIT Press.
Freeman, Marilyn/Auburn, Cat (2022) Cinema Divina and Autotheory: An Interview with Marilyn Freeman, in: Arts 11 (2022) 6. S. 122.
Girish, Devika (2025) Interview: Jafar Panahi on It Was Just an Accident, in: Film Comment, 27.05.2025. URL: https://www.filmcomment.com/blog/int-jafar-panahi-on-it-was-just-an-accident/ – aufgerufen am 23.06.2025.
Kamali Dehghan, Saeed (2010) Iran jails director Jafar Panahi and stops him making films for 20 years, in: The Guardian, 20. Dezember 2010. URL: https://www.theguardian.com/world/2010/dec/20/iran-jails-jafar-panahi-films – aufgerufen am 23.06.2025.
Kitnick, Alex (2018) I, etcetera. In: OCTOBER. 166 (2018) Herbst. S. 45-62.
Mohamadi, Narges (2025) Jafar Panahi, The Brave and Acclaimed Iranian Director Has Won The Palme D’Or, in: Narges Mohamadi Foundation, 26.05.2025. URL: https://narges.foundation/jafar-panahi-the-brave-and-acclaimed-iranian-director-has-won-the-palme-dor/ – aufgerufen am 23.06.2025.
N.N (o.J.) A Beginner’s Guide To Iranian New Wave, in: Cinema Waves Blog, o.J. URL: https://cinemawavesblog.com/movements-page2/iranian-new-wave/ – aufgerufen am 23.06.2025.
N.N. (2010) Iran: Filmemacher Jafar Panahi gegen Kaution frei, in: Tagesspiegel, 25.05.2010. URL: https://www.tagesspiegel.de/kultur/iran-filmemacher-jafar-panahi-gegen-kaution-frei-1819885.html – aufgerufen am 23.06.2025.
N.N. (2023) Jafar Panahi nach Hungerstreik in iranischem Gefängnis freigelassen, in: Spiegel, 03.02.2023. URL: https://www.spiegel.de/kultur/iran-jafar-panahi-nach-hungerstreik-auf-kaution-freigelassen-a-dbf05711-7550-4b1e-8fae-b5f1668cdae5 – aufgerufen am 23.06.2025.
Rist, Peter (2009) In Real Time: An Interview with Jafar Panahi, in: Offscreen, Volume 13, Issue 11, November 2009. URL: https://offscreen.com/view/interview_panahi – aufgerufen am 23.06.2025.
Wiegman, Robyn (2020) Introduction. Autotheory Theory, in: Arizona Quarterly: A Journal of American Literature, Culture, and Theory. 76 (2020) 1. S. 1-14.