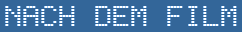Einfach zum Heulen
Einfach zum Heulen
AI QING WAN SUI (Vive l'Amour) von Ming-Liang Tsai, Taiwan 1994
Tränen im Kino, das bedeutet normalerweise schöne, kitschige Bilder, die einen zum Mitfühlen einladen. Die schöne Träne, die die Wangen der Geliebten runterrollt, wenn ihr Liebhaber losziehen muss mit unbestimmtem Ausgang. Die Tränen der Zuschauer, die das Glück gar nicht fassen können, wenn sich die beiden nach überstandenen Konflikten wieder in den Armen liegen. Geht man nicht auch ins Kino, um zu weinen, sich mit der Geschichte von Liebenden zu identifizieren und in der verklärten Schönheit ihrer Leiden Trost, oder angesichts der unerfüllten Hoffnung im Melodram Bestätigung zu finden?
Aber verklärt sollte dieses Leiden schon sein. Wer will denn rotgeränderte Augen und Rotznasen sehen. Keine glitzernden Tränen, sondern Geheule in seiner ganzen Hässlichkeit, das einen zurückstößt von dieser Figur, mit der man sich gerade so schön eingerichtet hatte. Und doch sind es gerade solche nicht konsumierbaren Szenen die im Gedächtnis haften bleiben.
Mir geht seit Jahren dieser Film nicht mehr aus dem Kopf – ein Film, in dem eigentlich nichts passiert. Drei Menschen in Taipei und ihr Alltag. Ihre ziellosen Wanderungen, die sich immer wieder in einem luxuriösen, leeren Appartement kreuzen. Eine Maklerin, die dieses Appartement vermitteln soll und ständig in leeren Wohnungen auf ihre Kunden wartet, natürlich umsonst. Der Mann, den sie beim einsamen Herumstreunen kennen lernt und mit dem sie ab und zu in dem Appartement Sex hat. Er ist ein Schieber, von dem sie deshalb nicht viel mehr wissen will. Der einsame Junge, ein Vertreter für Urnenplätze, der sich zunächst in das Appartement einschleicht um vor seiner Einsamkeit in noch größere Einsamkeit zu fliehen - mit aufgeschnittenen Pulsadern.
Die Bilder des Films sind statisch, so statisch wie das Leben der drei Protagonisten; die Blicke auf sie oft indirekt über Spiegel oder hinter Säulen hervor und aus ungewöhnlichen Winkeln. Der sehr harte Schnitt wird über den manchmal irritierenden, immer aber gedämpften Ton schon in der vorausgehenden Szene eingeleitet. So sieht man zu Beginn des Films nur einen Schlüssel in einem Schloss stecken, alles andere ist unscharf. Eine Hand tastet ihn vorsichtig ab und löst sich hastig als hinten im Gang eine Tür aufgeht. Die noch nicht erkennbare Person begibt sich zur Tür um eine Unterschrift einzuholen. Als die Tür sich wieder schließt, kommt die Person wieder nach vorne und nimmt in einer schnellen Bewegung den Schlüssel. Die Kamera blickt weiter starr auf das nun leere Schloss. Die ganze Szene ist so gut wie ohne Ton und wird abgeschnitten durch den zweiten Teil der Schwarzblende des Vorspanns. In diese drängt sich nun Kassengeräusch, das sich erst erklärt, als wir die Person von eben, die wir nun als den Jungen erkennen, einen Supermarkt durchstreifen sehen. Allerdings sehen wir ihn wieder nicht direkt, sondern über einen Überwachungsspiegel, in den er eine Weile starrt, nachdem er sich darin entdeckt hat, um sich schließlich die Haare zu richten.
Alle drei Protagonisten scheinen auf der Suche zu sein. Der Junge nach seiner sexuellen Identität, die Frau nach einem Partner, der Mann nach einem Versteck. Ihre Wege führen lange Zeit aneinander vorbei, bevor sie sich kreuzen. Sie verpassen sich und landen doch alle immer wieder in dem Appartement, einer Art Freiraum, in dem sie sich ausweiten und in der luxuriösen Badewanne untertauchen können. Vor allem der Junge probiert sich hier aus - in den Kleidern der Frau radschlagend, eine Melone als Bowlingkugel an die Wand jagend. Weil sie diesen Freiraum heimlich nutzen, müssen sie sich voreinander verstecken – oft unter dem Bett, auf das sich bald einer der anderen legt, um sehnsuchtsvoll zu träumen. Grausam wirkt die Liebesszene des Paares über dem Jungen – eine Szene zu dritt, von welcher der Zuschauer wie der Junge nur die Bewegungen der Metallfedern von der Unterseite des Bettes aus sieht. Die Kamera ist starr auf den Jungen gerichtet, welcher den Mann begehrt und in seiner Qual zu onanieren beginnt.
Es ist aber vor allem die auf die merkwürdige Dreierkonstellation folgende Schlussszene des Films, die haften bleibt. Während der Junge sich vorsichtig zu dem schlafenden Mann ins Bett legt, der ihn umarmt ohne es zu merken, versucht die Frau vergeblich ihr Auto zu starten. Der Blick der Kamera richtet sich auf eine trostlose, nicht fertiggestellte Parklandschaft. Als die Frau ins Bild gelaufen kommt folgt sie ihr, bis sie mit ihr auf gleicher Höhe in Echtzeit die schmutzigen Wege entlang läuft. Kahle Bäume, Mülleimer, Betonblumenkübel – man hört nur ihre Schritte und leises Zwitschern von Vögeln, die man nicht sieht. Die Kamera verlässt die Frau für einen 360 Grad Schwenk rund um den Park – eilige Menschen, Jogger, graue Hochhäuser und eine Autostraße, deren Lärm jetzt erst den Zuschauer erreicht. Als die Frau wieder ins Bild kommt fährt die Kamera vor ihr her mit dem Fokus auf ihrem Gesicht. Langsam, ganz langsam sehen wir es etwas entgleiten und ihren Mund sich leicht öffnen. Ein harter Schnitt auf eine Ansammlung von Parkbänken fokussiert einen Zeitungsleser im Vordergrund. Sie tritt im Hintergrund in das Bild und setzt sich. Wir hören leises Jammern, das zu einer Großaufnahme des Gesichts überleitet. Sie weint – nein, sie heult. Ihr Gesicht verzerrt sich, ihre Augen quellen zu, die Haare fallen ihr ins Gesicht. Ihr Wimmern wird lauter, sie heult wie ein Kind, verliert die Kontrolle über sich, holt krampfhaft Atem. Die ganze Trost- und Beziehungslosigkeit des Films verdichtet sich zu diesem schmerzhaftem Ausdruck der überhaupt der erste emotionale Ausbruch im ganzen Film ist. Wir sehen diese Tränen eine ganze Weile – 3 Minuten – eine kleine Ewigkeit im Kino. Dann fasst sie sich, kommt zu sich und erstarrt. Sie versucht, die Kontrolle über sich wieder herzustellen, streicht sich Haare aus dem Gesicht, wischt sich die Tränen aus den verquollenen Augen, putzt sich die Nase und fängt an zu rauchen. Sie kämpft immer noch – holt sehr heftig Luft und zieht die Nase hoch. Ihr Mund öffnet sich und sie fängt schließlich wieder an zu weinen, abgeschnitten vom Schwarzbild des Abspanns, in dem ihr Jammern noch lange nachklingt.
Der 1994 gedrehte Film des taiwanesischen Regissseurs Tsai Ming-Liang (THE RIVER) heißt AI QING WAN SUI (Vive l'Amour). Ein langsam arbeitender Regisseur, der auf seine acht Stunden Schlaf beharrt und mit keinem Produzenten zusammen arbeitet, der seine "Faulheit" nicht akzeptiert. Tsai Ming-Liang nimmt sich sehr viel Zeit für seine Drehbücher, was notwendig scheint für die Intensität seiner Bilder, die er nicht nur durchkonstruiert, sondern findet – dem Leben in Taipei entnimmt. Gerade für die Schlussszene von AI QING WAN SUI (Vive l'Amour) spielte der Zufall eine große Rolle. Gefragt von Bérénice Reynaud, ob er Szenen genau festlege oder noch am Set improvisiere, antwortet Tsai Ming-Liang:
"Ich verbringe viel Zeit mit einem Szenario, die Struktur festzulegen, das Thema. Eine der Dinge, die ich versuche vor allem zum Ausdruck zu bringen sind die Gefühle die Taipei in mir auslösen. Ich versuche, einen neuen Zugang zu bekommen, die Orte bestimmte Aspekte des Drehens bestimmen zu lassen. Für Vive l'Amour war das Ende das ich geschrieben hatte anders. Man sieht die Person der Yang Kuei-mei nach schnellem Sex das Appartement verlassen und sich im Park bei vollem Tageslicht wiederfinden. Und das gibt ihr die Moral zurück. Sie entscheidet sich, in das Appartement zurückzukehren, um den Typen wiederzufinden und mit ihm eine richtige Geschichte anzufangen. Aber eine Woche vor dem Ende der Dreharbeiten wusste ich, dass dieses Ende unmöglich sein würde: ich hatte verstanden, dass der Park nicht rechtzeitig fertig sein würde. Also fängst sie an zu weinen, als sie rausgeht und diese Baustelle sieht, diesen Schlamm; ihre Gefühle reflektieren diese trostlose Landschaft."1
Diese Tränen sind also einem Zufall zu verdanken. Sie wurden nicht geplant eingesetzt, um den Zuschauer in eine Geschichte einzubinden und ihn auf ein wahrscheinliches Happy End hinzuführen. Diese Tränen stehen für sich, haben genau wie die Frau kein Gegenüber. Ihr Schluchzen ist leise, selbst für den Zuschauer kaum vernehmbar und dennoch - weil dieser Film zwar kein Stummfilm aber quasi ein stummer Tonfilm ist, in dem so gut wie nicht gesprochen wird - von großer Intensität. Das verzerrte Gesicht der Frau ist die einzige Entgleisung im Film, die einzige "Hässlichkeit" in den durchkomponierten Bildern und gerade als solcher Ausbruch wird es zum Ereignis in der ansonsten fast statischen Narration. Es wird zum reinen Ausdruck, zum Affektbild im Sinne von Deleuze. Ein Affekt, der nicht sensomotorisch durch Handlung weitergeleitet wird, dem wir beim Entstehen zusehen können, der die Narration jetzt völlig stillstehen lässt und Raum und Zeit auflöst. Man identifiziert sich nicht mehr mit dieser Frau, sondern ist fasziniert von ihren Tränen, weil man solche Tränen so zum ersten mal sieht - auf der Leinwand. Weil man diese Tränen aushalten muss und unabhängig von Mitgefühl einfach sehen kann. Wodurch ihr Gesicht, die zur Landschaft gewordenen verquollenen Augen, dann auch wieder schön werden.
- 1Das zitierte Interview erschien in den Cahiers du Cinéma Nr. 516, September 1997, S. 35-37.