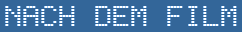ZU WORT KOMMEN LASSEN
ZU WORT KOMMEN LASSEN
Ein Rückblick auf die ersten Frankfurter Frauen Film Tage 2018
Film, und das zeichnet ihn aus, ist in der Vermittlung von Wirklichkeit nicht an die Abstraktion des Wortes gebunden, er kann den Körperausdruck vermitteln. Er vermag deswegen auch in Bereiche vorzustoßen, in denen das Emanzipations-, das Freiheitsverlangen, das Drängen auf Veränderung der Gesellschaft, der Wunsch darin aufgenommen zu sein, (noch) nicht in Worte gefasst sind. (Schlüpmann 2018: 8)
Selbstredend sind Sprechen und zu Wort kommen unerlässliche Prozesse politischer Praxis und Bewusstseinsbildung. Für eine feministische umso mehr, da es sich in patriarchaler Gesellschaft zu behaupten und zu positionieren gilt. Dass aber auch Schweigen ein ermächtigendes und potentes Mittel sein kann, sich Gehör zu verschaffen, erscheint in dieser Hinsicht erstmal paradox. Unter dem Schwerpunkt „100 Jahre Frauenwahlrecht – 50 Jahre feministische Filmarbeit“ der Frankfurter Frauen Film Tage, die im November letzten Jahres zum ersten Mal stattfanden, versammelten sich zahlreiche Filme, die sich explizit dem Stimmrecht und dem Finden einer Stimme widmeten. In dieser Hinsicht stach für mich ein Film besonders hervor, der gerade um das Nicht-Sprechen kreist. DIE STILLE UM CHRISTINE M., das Spielfilmdebüt der niederländischen Regisseurin Marleen Gorris aus dem Jahr 1982, zeigt, dass Nicht-Sprechen nicht nur passive Unfähigkeit bedeutet: Die Verweigerung zu sprechen kann auch ein subversiver Akt sein, indem sich der Vorrangstellung der Rede widersetzt wird.
A QUESTION OF SILENCE, so der englische Titel des Filmes, lässt die Debatte um die Möglichkeit oder Notwendigkeit feministischer Filmsprache in Abgrenzung zum narrativen Kino innerhalb der Filmtheorie und -kritik wieder aufscheinen. Denn, der Film mutet zunächst wie ein einfacher Krimi an und steht nicht für experimentelles „counter cinema“: Nach dem Mord an einem Boutiquenbesitzer, begangen von drei Frauen, versucht die Psychologin Janine van den Bos herauszufinden, warum die Tat verübt wurde. Sie soll ein Gutachten erstellen, das belegt, dass die Angeklagten wahnsinnig und unzurechnungsfähig seien. Warum sonst könne es zu einer solch spontanen Tat gekommen sein, so der vorschnelle Beschluss der Justiz. Das Merkwürdige dabei: die Frauen kannten sich nicht. Dass sie die Tat nicht bestreiten, aber auch nicht genau sagen, warum sie den Mord begangen haben, stellt die Psychologin vor ein Rätsel. Während Christine die Kommunikation gänzlich verweigert und gar nichts sagt (Abb. 1 und 2), redet und lacht Ann am laufendem Band über belanglose Dinge (Abb. 3), dreht Andrea die „Psychospielchen“ von Janine um, zeigt Unverständnis für das vernunft- und sprachbasierte Vorhaben der Psychologin und provoziert mit Körperlichkeiten (Abb. 4). Janine, die, auf der Suche nach einem Motiv, den Frauen immer näherkommt, entfernt sich zunehmend von ihrem Ehemann und bekommt schließlich ein Gespür für die alltägliche Unterdrückung, die diese Frauen schließlich zu einem Mord getrieben hat.
Wenn Schweigen zur Selbstermächtigung wird, muss durch Reden Macht ausgeübt worden sein. Während das Schweigen der dem Gericht unbekannten Zeuginnen, die sich ebenfalls in der Boutique aufhielten, als solidarischer Akt zu verstehen ist, ist die Stille, die Christine befallen hat, vielmehr pathologisch. Sie spricht schon lange nicht mehr. Oft lediglich assoziiert mit Schüchtern- und Unsicherheit oder als passiv degradiert, eignet sich der Film durch Christines Figur Schweigen als wirkungsvolles Ausdrucksmittel an. Still zu bleiben heißt hier nicht stumm zu sein und verweist nicht darauf, nichts zu sagen zu haben. Schweigen ergibt sich als Mittel dämliche Redner zu entlarven, Zustimmung zu verweigern oder Solidarität zu bekunden. Der Film enttarnt männliches Redeverhalten auf kluge und humorvolle Weise als gewaltvollen Akt und setzt gemeinsames Schweigen als solidarische Praxis: als Weigerung der Frauen, sich auf den Diskurs der Männer einzulassen, wie es Annette Förster in ihrer Einführung zur Festivalvorführung treffend beschreibt. In der Kritik auch missverstanden als Aufforderung zum Männermord geht es hier um die Sichtbarmachung patriarchaler Strukturen. Laut der Analyse von Gabriele Donnerberg, die 1984 in Frauen und Film erschien, ist dieser Mord nichts anderes
als eine Metapher in einer Geschichte, einerseits das ausdrucksstarke Bild für eine unwiderrufliche Beseitigung des Patriarchats, andererseits das filmische Strukturmoment, das die in der Geschichte verankerte Entwicklung des feministischen Diskurses trägt. (Donnerberg 1984: 62).
So wird der patriarchale Diskurs in der abschließenden Gerichtsverhandlung ad absurdum geführt: es mache doch keinen Unterschied, ob die Tat von Frauen oder von Männern begangen wurde, lautet die ignorante Aussage des Anwalts. Was folgt ist übergreifendes Gelächter, in das die vier stummen Zeuginnen einstimmen und das auch die in ihrer Funktion als Psychiaterin aussagende Janine befällt (Abb. 5 und 6). Ein Lachen, das sofort auf den vollen Kinosaal übergeht.
Das Lachen und die Stille vermitteln an dieser Stelle das Ausschlaggebende feministischer Praxis, in der Zuhören und Mitfühlen zentral sind, um unterdrückte Positionen zu allererst wahrnehmen zu können. Diese Elemente finden sich gerade in der Kinosituation wieder, die damit auf die Möglichkeiten feministischer Kinopraxis verweist. Außerdem ist „Einfühlsam-Sein“ eine Haltung, die Frauen* durch ihre Subjektivierung sehr früh vermittelt bekommen. Dass dieser Film dennoch ein Film über das Erheben der Stimme ist, zeigt die Figur der Psychologin: sie muss sich vor Gericht positionieren und nutzt diese Position, um sich für die Frauen auszusprechen. Auf den Einwand, der Film bediene sich in seiner Inszenierungsweise patriarchaler Identifikationsstrukturen, macht Donnerberg deutlich, dass das Werk durch die „filmische Inszenierung des Zuschauerblicks und seiner Koppelung an die feministische Perspektive“ (ebd.: 64) nicht einfach herrschende Funktionsmechanismen klassischer Erzählfilme übernimmt, sondern klug wendet. Sie kritisiert hierbei Ansätze psychoanalytischer Filmtheorie, die sich in deterministischer Annahme ödipaler Strukturen verstrickt und die weibliche Perspektive von vorn herein verunmöglicht. Die „realistische“ Darstellung stellt danach nicht lediglich ein illusionäres Einheitsgefühl her, das beispielsweise für die Filmtheoretikerin Claire Johnston immer die patriarchale Verleugnung von Differenz auf Kosten weiblicher Subjektivität beinhalte, sondern kann, wie der Film zeige, einen Solidarisierungsprozess vermitteln.1 Blickende Frauen*, sich abwendende, sich einander zuwendende Frauen* (Abb. 7 und 8). Die Inszenierung Gorris‘ entfaltet die Möglichkeiten anderer Blickstrukturen, die eine „neue Form von Solidarität [...] probiert, ein über Blicke und Lachen inszeniertes stummes Einverständnis, das mehr Kraft vermittelt als (männliche) Redegewalt.“ (ebd.: 72).
Der Wunsch nach Veränderung, der noch nicht vollständig artikuliert sein muss, das Recht zu dieser Art von Offenheit spiegelt sich im einleitenden Zitat von Heide Schlüpmann wider, die gemeinsam mit Karola Gramann und Gaby Babić als Kinothek Asta Nielson e.V. das Festival initiiert und das Programm gestaltet hat.2 Das Zitat entstammt der Einleitung zur festivalbegleitenden Publikation, die verschiedene Stimmen feministischer Filmarbeit versammelt, darin frühe Texte zum Kino sowie zu den ersten Frauenfilmfestivals. Warum es heutzutage noch relevant und notwendig ist, ein „Frauen“-Filmfestival zu veranstalten, zeigt der Blick in die Filmgeschichtsschreibung. So erscheinen bestimmte Positionen immer noch marginalisiert, der Bestand von Filmen von Frauen* ist erschreckend unterrepräsentiert.3 Die Kinothek setzt sich deshalb für die Sicherung und Herstellung von Filmkopien ein, um Werke einzelner Filmemacherinnen* zu bewahren. 2018 waren das alle Filme der Frankfurterin Recha Jungmann. Diese Kopien (wieder) öffentlich zu zeigen, heißt jedoch nicht,
zu isolieren, sondern den gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontext entschieden sichtbar zu machen – und damit auch, wie uns die Situation der Frauen nie alleine angeht, sondern im Zusammenhang mit der Situation anderer Menschen und mit der Verfasstheit unserer Welt. (Schlüpmann 2018: 6).
Den Fragen zur Sichtbarmachung und Bewahrung feministischer Filmarbeit schließen sich so Fragen der Verortung und Positionierung an, die im Programm durch den Einbezug verschiedenster Sichtweisen umgesetzt wird und durch ausführliche Einführungen gerahmt werden. Dass im Programm dennoch das Sternchen* bei ‚Frauen‘ fehlt, kann mit Charlotte Hannah Peters ebenfalls als eine Positionierung interpretiert werden. Ihren Gedanken zu Identität und Historizität schließt sich Jonathan Guggenbergers Festivalkritik an. Mit beiden lasse ich hier gemeinsam die Frauenfilmtage Revue passieren.
Speaking up, zu Wort kommen; der Titel des Begleitbandes, ließe sich an dieser Stelle noch erweitern: zu Wort kommen lassen. Raum geben für andere Perspektiven, für andere Geschichten, aber eben auch für Halbsätze und Unfertiges. Die theoretische Hinwendung zum Kinoraum wie sie Schlüpmann in ihrem Essay „Raumgeben“ resümiert, lässt die historische und politische Bedeutung des Ortes Kino deutlich werden, die sich auch bei Remake, den Frankfurter Frauen Film Tagen abzeichnet. Verkörpert das Kino „einen Schwebezustand zwischen Erinnern und Hoffen“ (Schlüpmann 2018), können wir diesen Zustand auch hinsichtlich unserer Vorfreude auf das diesjährige Remake attestieren, das vom 26. November bis 1.Dezember 2019 erneut in Frankfurt stattfindet.
Der Fokus auf Diskussionen und Gespräche machen das Festival zu einem ein Ort der Artikulation. Mit dem Ziel sich herrschender Repräsentation zu widersetzen, sich anderen Ausdrucksmöglichkeiten zu bedienen. Am Beispiel von DIE STILLE UM CHRISTINE M. zeigt sich dies durch die Verlagerung der Emotionalität auf diskursiver Ebene, die fasziniert, jedoch „aber nicht vergleichbar [ist] mit der Empfindung, von der emotionalen Gewalt des Kinoerlebnisses aufgesogen und in dumpfer Erschlagenheit zurückgelassen zu werden, sondern es ist eine Begeisterung, die zur Reflexion und Artikulation drängt.“ (Donnerberg 1984: 62). Artikulieren heißt in diesem Sinne Solidarisieren. Und das wird nicht nur spürbar im Kinoraum.
- 1Der Text „Warum ‚Die Stille um Christine M.‘ kein ‚patriarchales Erzählkino‘ ist, obwohl theoretisch alle Bedingungen dazu erfüllt sind“ möchte so das Konzept der Suture für eine feministische Filmtheorie fruchtbar machen.
- 2Das Zitat verweist an dieser Stelle auch auf die Bedeutung des Vor-Sprachlichen für eine Konzeption psychoanalytisch-informierter Filmtheorie, wie sie von Gertrud Koch und Heide Schlüpmann betont wird.
- 3Marleen Gorris‘ Filme erscheinen hier noch relativ gut gesichert: im Falle von De Stilte Rond Christine M. hat der niederländische Verleih eyefilm eine unbeschädigte Kopie, die einzige in Deutschland erhältliche aber ist extrem rotstichig.
Donnerberg, Gabriele: Warum ‚Die Stille um Christine M.‘ kein ‚patriarchales Erzählkino‘ ist, obwohl theoretisch alle Bedingungen dazu erfüllt sind. In: Psychoanalyse und Film. Frauen und Film, Heft 36. Frankfurt am Main, 1984. S.61-72.
Schlüpmann, Heide: Raumgeben. Berlin, 2019. https://www.nachdemfilm.de/essays/raumgeben (zuletzt aufgerufen 15.10.19)
Schlüpmann, Heide: Remake. Frankfurter Frauen Film Tage. In: Zu Wort kommen. Eine Publikation zu Remake. Frankfurter Frauen Film Tage 2018. Frankfurt am Main, 2018. S.4-9.