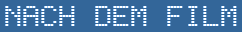Fiktionen des Dokumentarischen – Zur 31. Duisburger Filmwoche 2007
Fiktionen des Dokumentarischen – Zur 31. Duisburger Filmwoche 2007
Eine paradoxe Definition: Dokumentarisch ist genau der Film, der sich um Wirklichkeit nicht zu sorgen braucht. Auf diese – stark verkürzte – Pointe jedenfalls lassen sich die Überlegungen bringen, die der Film- und Medientheoretiker Vrääth Öhner in einer Lektüre der Schriften von Jacques Rancière im Rahmen der diesjährigen Duisburger Filmwoche vorstellte. Die Begründung: Das Charakteristikum des ohnehin im Realen geerdeten Dokumentarfilms bestehe gerade im Verzicht auf den Realitätseffekt, darauf, ständig verbissen den Wirklichkeitsgehalt des Gezeigten betonen zu müssen – während ein Spielfilm sich genau daran mithilfe der bekannten analogen oder digitalen Illusionsstrategien abarbeiten muss. So ist der Dokumentarfilm in der Konsequenz freier, und nicht etwa gebundener im Umgang mit fiktionalen Verfahren, was wörtlich verstanden heißt: mit Verfahren des Arrangements von vorgefundener Wirklichkeit.
Wie zum Beweis liefen im Duisburger Programm mehrere Filme, die dasselbe Sujet – Menschen auf der Verliererseite der Gesellschaft, die Wünsche und zerstörten Illusionen derjenigen, die von Anfang an keine Chance hatten – mit völlig unterschiedlichem Zugriff präsentierten. So rückten Stefan Kolbe und Chris Wright in DAS BLOCK ihre Protagonisten, vier Bewohner eines Mietshauses in Sachsen-Anhalt, mit der radikalen Prämisse ins Bild, dass kein Establishing Shot oder Kameraschwenk von der Perspektive der Porträtierten ablenken dürfe. Die Kamera präsentiert lauter Gesichter in distanzloser Großaufnahme, abgetrennte Teilkörper, deren Selbstaussagen durch eine kurzatmige Montage zudem einen Hang ins Paranoide bekommen. In der anschließenden Diskussion wurde der Film vorhersehbar kontrovers aufgenommen – die einen warfen ihm vor, einem dermatologischen Furor zu erliegen und seine Figuren, die ohnehin schon die exzentrische Position einnehmen, bis ins Groteske zu verzerren (ein Effekt, der sich schon optisch durch die gewählte Linse einstellte). Andere verteidigten DAS BLOCK mit dem Hinweis, dass er selbst als misslungenes Experiment immerhin ein formales Wagnis eingehe und sich zutraue, überkommene dokumentarfilmische Konventionen in Frage zu stellen. DAS BLOCK funktioniert weniger als Film, denn als Frage: Entsteht die Distanz, die ein Dokumentarfilmer zu sozial marginalisierten Protagonisten einhält, aus Respekt oder gewissermaßen aus Kontaktangst? Schreibt er, indem er auf Strategien der Empathie setzt, nicht gerade deren Opferstatus fest? Die Filmemacher selbst betonten, dass sie in den Interviews den sozial anerkannten Abstand zwischen einander vertauten Gesprächspartnern eingehalten hätten; dieses Argument verkennt freilich den Umstand, dass die Kamera den Raum dazwischen noch erheblich verkürzt und allemal anders (und anderes) sieht als das menschliche Auge.
Thomas Heises Porträt einer ostdeutschen Kleinfamilie KINDER. WIE DIE ZEIT VERGEHT verfolgte die gegenteilige Bildstrategie zu den gewissermaßen labortechnischen Detailvergrößerungen von DAS BLOCK. Immer wieder setzt der Film Landschaft leinwandfüllend ins Bild, unter anderem riesige Kerosintanks einer ehemals staatseigenen, jetzt privatisierten Ölraffinerie, Militärtransporter im unwirklichen Licht der Scheinwerfer des Leipziger Flughafens. Er habe beschlossen, den Film auf Schwarzweiß zu drehen, so Heise in der Diskussion, damit nichts im Bild von den Protagonisten ablenke: »Schwarzweiß kann nicht brüllen.« Wie die Zeit vergeht zeigt der Film in seinem Prolog, in Aufnahmen aus Heises älterem Film NEUSTADT (STAU – STAND DER DINGE): Dort erzählt die noch junge Mutter von ihren beiden Söhnen, von Fehlern, die begangen wurden und von den Träumen, die sie sich noch erfüllen will. Der Film spürt dann dem nach, was die Zeit mit sich gebracht hat: Die Mutter ist, wie sie es vorhatte, Busfahrerin geworden. Ihr jüngerer Sohn hätte die Noten für eine höhere Schulbildung, jedoch keine Lust darauf (»die Mutter will es auch nicht«), seine ganze Begeisterung gehört dem Fußball. Sein großer Bruder bricht wie erwartet immer wieder die Schule ab. Den Umgang mit seinem rechtsradikalen, schon erwachsenen Freund lässt er sich nicht verbieten. Mitunter scheinen die Protagonisten wie aus ihrer Zeit gefallen; der ICE rauscht in Hochgeschwindigkeit vorbei, die Menschen gehen zu Fuß ihrer staubigen Wege.
Auch KEHRAUS, WIEDER von Gerd Kroske (wie Heises Film in Duisburg passenderweise genau am 18. Geburtstag des Mauerfalls aufgeführt) findet seine Akteure im Osten Deutschlands und handelt vom Vergehen der Zeit. Im Vergleich zum Heise-Film wird die Tonlage aber deutlich düsterer, die Perspektivlosigkeit unerfüllter Hoffnungen geradezu greifbar. Zum dritten Mal nach 1990 und 1996 filmt Kroske ehemalige Straßenkehrer in Leipzig. Zwei seiner Figuren sind mittlerweile verstorben, ihr Schicksal rekonstruiert der Film anhand von behördlichen Akten, Sozialamtsunterlagen, Obduktionsberichten: Überfülle an amtlicher Verdatung einerseits, andererseits notiert das Polizeiprotokoll, man habe bei dem in seiner Wohnung aufgefundenen Toten keinerlei persönliche Papiere gefunden. So kann man KEHRAUS, WIEDER auch als Dokument-Film lesen, als Versuch über das Dokument: Was bleibt, sind papierne, vergängliche Register und Aufzeichnungen sowie – und das ist das Entscheidende – die Menschen, die diese Aufzeichnungen lesen, vorlesen, sich erinnern, oder eben nicht erinnern. Das Dokument ist das, was verkörpert, was zur Sprache gebracht werden muss (sonst bleibt es tot). Das Monument – als Gegenbegriff zum Dokument – insistiert in seiner Massivität, es verspricht, in alle Zukunft zu sprechen (und wird stumm und blank doch gerade in dieser monumentalen Selbstbezogenheit, darin, dass es niemanden braucht, der es ausspricht.) KEHRAUS, WIEDER verfährt sozusagen konsequent anti-monumental, so dass die Kamera von einem der Verstorbenen nicht einmal mehr das Grab findet: bei einer Sozialurnenbestattung erinnert kein Kreuz und keine Tafel an denToten, dessen letzte Ruhestätte nur durch Tabelle und Koordinatensystem rekonstruiert werden kann.
Vom Umgang mit Toten – genauer: mit dem Tod der eigenen Mutter – handelten auch SIEBEN MULDEN UND EINE LEICHE von Thomas Hämmerli und Marcus Carneys THE END OF THE NEUBACHER PROJECT. Gegensätzlicher könnten zwei Filme kaum ausfallen. Hämmerli filmt mit wackliger Handkamera die Wohnung der eigenen, dort verstorbenen Mutter. Weil sie lange nicht gefunden wurde, steckt der Leichengeruch in der Wohnung. Den kann Hämmerli dem Zuschauer nicht vermitteln, wohl aber den Ekel, den er empfunden hat, erst »live« wie ein Kriegsreporter, dann zunehmend mit den stilistischen Mitteln des Trash-Fernsehens. Was die Mutter an Objekten, Kleidungsstücken, Zeitschriften, Essensvorräten, Katzenstreu, Gipsstatuen, Blumentöpfen, Glühbirnen, Gläsern, Kurzwaren, Schuhen, Spiegeln, Wollresten, Nützlichem und Befremdlichem, Gebrauchtem und nie Ausgepacktem, an schierem dinglichem Überfluss über viele Jahre in krankhafter Manie aufgehäuft hat, ist nun weder Dokument noch Monument, sondern schlicht Abfall und Zuviel. Hämmerli und sein Bruder machen kurzen Prozess mit allem, was ihnen ihre Mutter hinterlassen hat. SIEBEN MULDEN UND EINE LEICHE und eine Leiche verfolgt die mehrwöchigen Aufräumarbeiten der beiden und dekliniert eine doppelte Bewegung: Während die Wohnung immer leerer wird, nimmt das Porträt der Mutter (und der Schweiz in den 50er Jahren) immer deutlichere Züge an: Waffenindustrielle und Adlige waren unter den Vorfahren, Herkunft und Heirat wohlhabend, die Aussichten schienen vielversprechend – Fassadenwelt. Die Furie des Verschwindens, die der Film ist, lässt zugleich eine neues, facettenreicheres Bild der Mutter entstehen.
Während Hämmerli einen rotzig-respektlosen, zynischen Film über die eigene Mutter abgeliefert hat, hält THE END OF THE NEUBACHER PROJECT einen langwierigen Prozess des Umdenkens seiner Herkunft gegenüber fest. Die Eröffnungssequenz des Films, der sein eigenes Ende oder Scheitern schon im Titel ankündigt, versammelt alle späteren Motive, zeigt uns das Ganze als Miniatur kurzer, emblematischer Szenen. Eine subjektive Kamera, die das rustikale Dekor einer Wohnung abtastet wie in einem dilettantischen Home Video: handgeführt, uneben ausgeleuchtet, zu nahe dran an den Dingen. Zuhause, das sind Vögel im Käfig, tote Tierköpfe an der Wand und festlicher Osterschmuck. Dann folgt eine Situation des Pflegens. Eine Ärztin bei der Arbeit, wie wir später erfahren: die Mutter des Filmemachers. Dann eine Jagdgesellschaft im Wald. Ein Mann in Jägertracht, das Gewehr über der Schulter. Dann Regisseur Carney selbst, beim Pitching seines »Projektes« vor einem Auditorium. Ein Film über »Morbus Austriacus« solle es werden, über die österreichische Krankheit des Schweigens und Verleugnens der dunkelbraunen Vergangenheit, durchdekliniert anhand der Verwicklungen der eigenen Familiengeschichte mit dem Nationalsozialismus. Zornig und anprangernd setzt Carney dazu an, über die Verfehlungen seiner Vorfahren zu berichten, da wird unvermittelt der Ton ausgeblendet. Im Voice Over kommentiert der Regisseur seine einstigen Pläne mit mildem Sarkasmus:»Damals hatte ich noch keine Ahnung, wie konkret diese Krankheit werden würde.«
Das ist nicht nur zu einem späteren Zeitpunkt, sondern in einem gänzlich anderen Kontext gesprochen. Die »Krankheit« ist nicht mehr kollektiv, sondern individuelles Schicksal seiner Mutter. Diagnose: Lungenkrebs. Damit hatte Carney nicht gerechnet. Anstatt zur Anklage, die ihn endgültig in Distanz zur eigenen Herkunft gesetzt hätte, wird der Film, nach knapp achtjähriger Produktionsphase, in wahrlich letzter Minute zum Vehikel einer verspäteten Liebeserklärung an die Mutter. Wenn das Projekt der Familie Neubacher, wie Carney einmal bitter bemerkt, stets im Verschweigen bestanden hatte, dann kann das »Ende« des Filmtitels auf zweierlei Arten gelesen werden – als das endliche Zur-Sprache-Bringen der Familienschuld genauso wie als das Scheitern von Carneys vermutlich ursprünglicher Absicht, zwischen Täterenkel und Täterkindern einen unüberwindbaren Graben zu ziehen.
Carneys Vorfahren waren prominente Mitglieder der Nazi-Elite. Der Großvater Eberhard Neubacher war Direktor des Lainzer Tiergartens und veranstaltete Jagdausflüge für Parteimitglieder und Nazi-Funktionäre, darunter Hermann Göring, der dem Opa eine Flinte schenkte, die immer noch in Familienbesitz und Gebrauch ist. Eberhards Bruder Hermann war bereits Mitglied der österreichischen NSDAP, als diese noch illegal war und wurde nach dem »Anschluß« von Hitler in den Rang des Bürgermeisters von Wien erhoben. Später war er als »Sonderbeauftragter Südost« unter anderem mit der Ausplünderung Rumäniens, Serbiens und Bulgariens beauftragt. Das Unternehmen, dokumentarisch die Vergangenheit des Dritten Reiches in der Gegenwart der eigenen Familie aufzuarbeiten, verbindet das THE END OF THE NEUBACHER PROJECT mit einer Reihe anderer Dokumentarfilme jüngerer Zeit, etwa mit DAS WIRST DU NIE VERSTEHEN (2003) von Anja Salomonowitz oder mit 2 ODER 3 DINGE, DIE ICH VON IHM WEIß (2005) von Malte Ludin.
Den größten Spiel- und Freiraum im Arrangieren von Wirklichkeiten hat sich Philip Scheffner mit THE HALFMOON FILES genommen. Darin versucht Scheffner den heute nur noch schwach nachwirkenden Faszinationspotentialen der Medien nachzuspüren, die in ihren Anfängen immer auch als okkulte Medien, als Portale zum Jenseitigen, verstanden wurden. Allerdings sucht und findet er seine Gespenster nicht in verrauchten Hinterzimmern, sondern in den genau vermessenen Archiven von Humanwissenschaft und Geschichtsschreibung. Ausgangspunkt ist eine Stimme, die eine weite Reise hinter sich hat: von Indien ins Deutsche Reich, aus dem Ersten Weltkrieg in die Gegenwart. Diese Stimme hebt mit der Formel an, mit der sonst Märchen beginnen:»Es war einmal ein Mann. Er geriet in den europäischen Krieg. Deutschland nahm diesen Mann gefangen. Er möchte nach Indien zurück. Wenn Gott gnädig ist, wird er bald Frieden machen. Dann wird dieser Mann von hier fortgehen.«
Am 11. Dezember 1916 in einen Phonographentrichter gesprochen, in Wachs geritzt, in eine Schellackplatte gepresst, wanderten diese Worte ins Archiv der »Königlich Preußischen Phonographischen Kommission«. Heute lagern sie, eine Ablage unter vielen Tausend, im Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin. Aus dem hat Scheffner sie entborgen, um sie wieder in eine Frage zu verwandeln: Ist dieser Mann, den die mit preußischer Gründlichkeit geführten Dokumente als Mall Singh, Kolonialsoldat im Dienste der britischen Armee, identifizieren, schließlich heimgekehrt? Ist es 90 Jahre später möglich, ihn heimkehren zu lassen?
THE HALFMOON FILES ist das Ergebnis der mehrere Jahre währenden Beschäftigung Scheffners mit dieser Tonaufnahme, die den Regisseur an die unterschiedlichsten Orte geführt hat. Orte, an denen das Vergangene und das Gegenwärtige, das Fremde und das Eigene wie übereinander projiziert erscheinen. So in einer Kneipe in Wünsdorf nahe Berlin, in der eine Postkarte hängt, die eine Moschee zeigt, die einst in Wünsdorf stand. Das Deutsche Reich ließ sie für die gefangen genommenen Kolonialsoldaten errichten, die dort im Sonderlager »Halbmond« interniert waren. Das Kalkül: Wenn England und Frankreich die Feinde sind, dann sollte es doch gelingen, die muslimischen Soldaten ihrer Kolonien durch gute Behandlung zum kollektiven Widerstand gegen ihre Besatzer zu überreden. So wurde unter Kaiser Wilhelm II. der Djihad Teil deutscher Kriegsstrategie.
Mit äußerster Behutsamkeit rekonstruiert der Film die Zusammenhänge einer Allianz aus Militär, Wissenschaft und Propaganda. Scheffners Umgang mit seinem historischen Bild- und Tonmaterial ist nicht nur meilen-, sondern geradezu galaxienweit entfernt von den Ton-Bild-Konfitüren, die ein gedankenloses Geschichtsverständnis à la Guido Knopp uns massenhaft im Fernsehen anrührt. Menschen, die unter reichsdeutscher Verwaltung nur Nummern waren, erhalten hier ein Gesicht. Scheffner gibt dem Archiv seine Würde zurück, präsentiert seine Dokumente wie selbständige Individuen und macht den Vorgang der Recherche selbst zum dramaturgischen Leitfaden seines Films. Wer Gespenstern hinterherjagt, wird nicht zu fassen kriegen, was er sucht, er wird auf dem Weg aber mehr finden, als er zu hoffen gewagt hat. – Es ist solche Offenheit im Zugriff aufs Sujet, der wache Blick und die Bereitschaft, der Wirklichkeit auf ihre oft verschlungene Spur zu kommen, die die besten Beiträge der Duisburger Filmwoche 2007 ausgezeichnet hat.