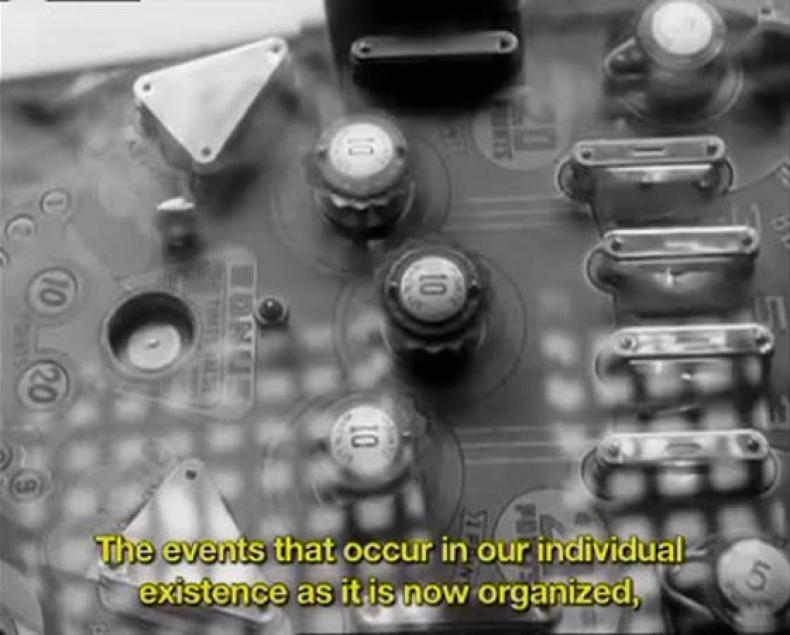Flipperautomat als Kinogeschichte
Flipperautomat als Kinogeschichte
„Es gibt zur Zeit keinen besseren Flaubert als den Flipper.“ (Friedrich Wolfram Heubach)1
Für eine kurze Dauer wird aus dem Flipperautomaten eine Diskursmaschine. Insbesondere in den 1970er Jahren eignet sich dieses massenkulturelle Spielgerät – wenn auch in wenigen Aufsätzen und Studien – als Gegenstand diverser Theorien und Disziplinen: semiologisch-ethnologisch (vgl. Oppitz 1974b), kunsthistorisch (vgl. Hainz 1970), dialektisch-materialistisch (vgl. Warneken 1974), psycho-mythologisch-materialistisch (vgl. Heubach 1987)2, sozialempirisch und psychoanalytisch (vgl. Meistermann-Seeger/Bingemer 1971)3, systemtheoretisch (vgl. Schimank 1999)4 oder zen-buddhistisch (vgl. Polin/Rain 1979a)5 wird dem Flipper beigekommen.
Eine distinkte Theoriebildung, gar wie etwa beim Massenmedium Film die Etablierung eines eigenständigen akademischen Fachs, bleiben dem Flipperautomaten erspart; ein Menetekel ist vielleicht ein in den 70er Jahren vorbereiteter Band zum Flipper, den der Kunsthistoriker Benjamin Buchloh herausgeben will, um ihn dann schließlich doch zurückzuziehen. Folgerichtiger ist freilich, dass die Popularität des Flippers zwar groß ist, aber eher kurz währt und längst vorüber ist (ganz anders als die des geselligen Kickerkastens).6 Heutzutage werden nur noch wenige neue Modelle produziert, und der Automat findet noch vereinzelt Obdach in Kneipen, Spielhallen und Hobbykellern von sammelnden Liebhaber_innen.
Dass mitunter auch noch in Kinoentrées Flipper stehen, ist Überrest eines innigen Verhältnisses zweier Massenkulturen. Denn gäbe es tatsächlich so etwas wie eine „Pinball-ology“7, dann nämlich müsste einer ihrer Stränge die historische Verquickung von Flipper und Kino sein. Finden sich auch in Literatur8, Theater9, Skulptur10, Malerei11, Fotografie12, Musik13, Mode14 oder Comic15 Bezüge, weist das Kino eine besondere Affinität zum Flipper auf. Sie lässt sich in drei Komplexe rubrizieren: 1. Der Flipper als Ausstattungsobjekt, Motiv und Zeichen im Film; 2. Kino und Flipper unter einer korrespondierenden ideologiekritischen und marxistischen Perspektive, bezogen auf den Kapitalismus fordistischer und kulturindustrieller Form; 3. Der Flipper als Merchandisingprodukt des Films, darin dessen Paratext wie Adaption. Diese Rubriken entsprechen darüber hinaus einer mehr oder weniger zeitlichen Abfolge im Verhältnis beider Massenkulturen. Dessen Modifikationen auszuloten, erzählt eine kleine Kultur- und Wissensgeschichte des Flippers via Film und Kino, die mit den anfangs genannten theoretischen Ansätzen korrespondiert und trotzdem einen eigenständigen Diskurs ausbildet, der Aspekten der Theorie vorgreift, sie weiterschreibt oder andere Akzente setzt. Und schließlich reflektieren jene Transformationen im Verhältnis von Flipper und Kino en miniature Transformationsprozesse westlicher Arbeits- und Lebensverhältnisse. Paolo Virno geht – weniger ironisch, als es zunächst erscheinen mag – so weit, am allmählichen Verschwinden des Flippers Anfang der 1980er die ökonomische und soziokulturelle Zäsur der Nachkriegszeit festzumachen: „Le régime capitaliste [...] a connu deux phases distinctes, voire incommensurables. La première va de la fin de la guerre à la disparition des flippers, la seconde commence justement du jour où l’on a exterminé ces machines du caprice humain.“16 Mit dem Blick vom Kino auf den Flipper wird dieser Umbruch noch konturiert.
1. Der Flipper als Ausstattungsobjekt, Motiv und Zeichen im Film
Eine Möglichkeit, das Verhältnis der Filmgeschichte zum Flipper zu ermessen, ist quantitativ: Etwa über den Suchbegriff „pinball“ auf der Internet Movie Database (IMDb) oder mittels der tabellarischen Ordnung der Internetseite Pinball in the Movies,17 die sich zum Ziel setzt, nicht nur sämtliche Filme, in denen Flipperautomaten, egal wie peripher, vorkommen, sondern auch die jeweiligen Modelle (Name, Produktionsjahr, Herstellerfirma) aufzulisten: Filme als Flipperarchiv.18 Eine andere Variante ist, Filme nach dem spezifischen visuellen und akustischen Erscheinen der Flipper sowie ihrem narrativen und thematischen Zusammenhang zu befragen.
Schulen, Staatsapparate, Automaten
Gefragt nach den Gemeinsamkeiten des jungen französischen Nachkriegskinos, nach Stil und Themen einer neuen Schule, antwortet François Truffaut ziemlich launig: „Je ne vois qu’un point commun entre les jeunes cinéastes : ils pratiquent tous assez systématiquement l’appareil à sous, contrairement aux vieux metteurs en scène qui préfèrent les cartes et le whisky.“19 Später präzisiert er: „Le seul trait commun des auteurs Nouvelle Vague était leur pratique du billard électrique“.20 Wo Truffaut den generationellen Unterschied zum Altherrenhaften von Kartenspiel und Whisky in der gemeinsamen Leidenschaft der jungen Regisseure für den Flipper („l’appareil à sous“ / „billard électrique“) ausmacht, wird die eigentliche Frage nach einer filmstilistischen Homogenität der so genannten Schule der Nouvelle Vague scheinbar unernst, spielerisch ausgekontert. Doch ist die gewitzte Abwehr der Frage politisch, weil mit ihr überhaupt das Konzept der Schule negiert wird – mit dem Verweis auf den massenkulturellen Zeitvertreib.
Doch trifft Truffaut unwillkürlich etwas tatsächlich Verbindendes des jungen französischen Kinos, durchstreift man Filme der 1960er Jahre: Der Flipper ist immer wieder Teil der Kulisse. Mehr noch als zeitgeschichtliches Kolorit, z. B. der Pariser Bistros jener Jahre, wird der Flipper dort zum Zeichen von Initiation und Systemkritik.
Wenn in LES QUATRE CENTS COUPS (F 1959) die Schule geschwänzt wird, dann erweist Truffaut diesem ideologischen Staatsapparat den gleichen Respekt, den er für die Idee einer stilprägenden Schule des jungen französischen Kinos übrig hat. Als Kontrast wird auch in LES QUATRE CENTS COUPS die Massenkultur positioniert. Die Lausbuben lassen das Klassenzimmer Klassenzimmer sein und suchen stattdessen die Affektion ihrer Körper:21 im Kino, beim Flippern im Café und in einem Rotor, einer runden, sich rasant drehenden Box auf der Kirmes.
Die Szene am Flipperautomaten ist sehr kurz und evoziert beispielhaft juvenile, urbane Freizeitbeschäftigung. Das Flippern ist aber auch Teil eines somatischen Dreisatzes: vom regungslos gebannten Schauen auf die Leinwand, zum Stehen beim Flippern – für das es allein die schnelle Reaktion der Finger und die ruckhafte Bewegung der Hüfte braucht –, bis hin zum lustvoll entmächtigten Körper Antoines (Jean-Pierre Léaud), durch Fliehkraft an die Holzbretter des Rotors gepresst. Ganz anders als beim Fußballspielen am Filmende, das disziplinarische Einübung ins Kollektiv ist, liefern sich die Körper der Kinder hier auf a-soziale, nicht zwanghaft soziale Weise, Maschinen, Apparaten, Automaten aus. Währenddessen sprechen die beiden Jungs fast nichts. Nicht zuletzt in diesem Aussetzen verbaler Kommunikation bilden Kino, Flipper und Rotor das Konträre zum Aufgerufenwerden, zum Rede-und-Antwort-stehen-Müssen in der Schule,22 zur Althusser’schen Anrufung.23 Die genussvolle Unterwerfung unter die Automatismen des Ablaufens der Filmspule, des Rollens der Flipperkugel, des Kreiselns auf dem Jahrmarkt und die damit einhergehende Entbindung vom Sprechzwang sind das Andere gegenüber dem ideologischem Staatsapparat Schule und dessen Subjektivierungspraxis.
Keine Schüler mehr sind die Taugenichtse in LES MAUVAISES FRÉQUENTATIONS / DU CÔTÉ DE ROBINSON (F 1963) von Jean Eustache.
Der Film eröffnet mit einer Flipperpartie, dann ziehen die jungen Männer in anmutiger Verschlagenheit – als Motto wird zu Beginn „Quand je joue je gagne“ ausgerufen – durch Pariser Straßen und Tanzlokale, um schließlich eine Frau um ihr Portemonnaie zu erleichtern. Das Flippern trägt zur Atmosphäre des Paris der 1960er und dessen Jugendkultur bei (ähnlich tut dies auch das Herumschlendern zwischen den Flippern in Jean Hermans Experimentalfilm ACTUA-TILT (F 1960)). Die Gesinnung der Halunken bei Eustache ist in der Pose beim Flippern schon komprimiert, „eine ungezwungene, untätige oder kokette Haltung, [...] diese[...] theatralische[...] Aufmerksamkeit unserer westlichen Spieler, die in kleinen, untätigen Gruppen um den Flipperautomaten streichen und wohl darauf bedacht sind, den übrigen Besuchern des Cafés das Bild eines kennerhaften und gewieften Gottes zu vermitteln“,24 wie es Roland Barthes im Unterschied zum japanischen, flipperähnlichen Automatenspiel Pachinko bemerkt.25 Der Flipper, an dem die jungen Männer in LES MAUVAISES FRÉQUENTATIONS spielen, kündet dagegen gar nicht von jungen Göttern, sondern sieht kassandrahaft deren kommendes Treiben voraus: das Modell heißt „Gaucho“ und verweist so etymologisch auf „Wegelagerer“. Die Gassen und Lebenswege sind hier gleichermaßen abschüssig, sie entraten gewollt kleinbürgerlicher Rechtschaffenheit. Mit Friedrich Heubach findet sich eine Entsprechung zu den Bahnen des Flippers: „Die schiefe Ebene, vor der – als Akzidenz begriffen – im bürgerlichen Bewußtsein noch die Moral bewahren kann [...], wird hier [d.i. der Flipper; D.G.] zum resignativen, heroisch-zynischen Prinzip von Existenz.“26
Sprache, Stadt, Liebe
Anders als in LES QUATRE CENTS COUPS haftet dem Flippern in Filmen Jean-Luc Godards nichts Eskapistisches an. Die Macht ist hier nicht am anderen Ort des ideologischen Staatsapparats (der Schule, dem Internat), sie zeigt sich darin, dass alle sich ständig als Subjekte anrufen. Bei Godard tritt der Flipper im Zusammenhang der verfremdenden Darstellung alltäglicher Situationen auf, zu denen sich der Automat als Kommentar verhält.
Etwa im Zwist zweier Getrennter: Die Gesichter der Frau und ihres Verflossenen sind am Anfang von VIVRE SA VIE (F 1962) der Kamera verborgen, die stattdessen die Hinterköpfe beim zähen, resignierten Streit in den Blick nimmt; allenfalls im Spiegel hinter dem Bartresen, an dem sie hocken, sind die Gesichter verschwommen zu sehen. Irgendwann gehen die beiden zu einem Münzautomat (wie die deutsche Übersetzung der filmischen Zwischentitel den Flipper nennt), weil sie sich nichts mehr zu sagen haben.
Teilnahmslos verrichten sie das Spiel, wechseln sich ab, während die Konversation in Belanglosigkeiten und Bruchstückhaftem versandet: Keine Fragmente einer Sprache vergangener Liebe mehr, nurmehr unmotiviertes Flippern. Erst am Automaten geraten die Vorderköpfe ins Bild, aber die Gesichter sind ausdruckslos.
Verstreut ist das Motiv des Flippers auf visueller und akustischer Ebene in MASCULIN FÉMININ (F 1966): wenn Jean-Pierre Léaud den Flipperknopf weniger drückt als haut, um sofort das Interesse am Spiel zu verlieren, oder wenn eine junge Frau im Vorübergehen den Flipperabzug zieht, ohne sich dann weiter um den Lauf der Kugel zu scheren. Am Flipper wird sich en passant und unkonzentriert abreagiert. Wenn Léaud einmal länger am Automaten spielt, wird sein aggressives Spiel musikalisch mit dem Lied „Si tu gagnes au flipper“ verdoppelt.
Die Rastlosigkeit, Angespanntheit und Sprunghaftigkeit, die den gesamten Film beherrschen, verdichten sich im achtlosen Flippern ebenso wie in der narrativen und ästhetischen Beiläufigkeit, mit der es MASCULIN FÉMININ als Motiv behandelt.
Konzentrierter ist der Flipper in seiner Zeichenhaftigkeit in 2 OU 3 CHOSES QUE JE SAIS D’ELLE (F 1967), wo er als Bildhintergrund und Geräuschkulisse von drei, parallel montierten Sprachsituationen in einem Pariser Café fungiert.
Das erste Gespräch findet zwischen einer jungen Frau und einem am Nebentisch sitzenden Mann statt. Hinter den beiden sind zwei Flipperautomaten arrangiert, an einem spielt eine gestandene Dame in stoischer Manier und mit Zigarette. Der Mann sagt zur Frau, dass man im Kino nicht wirklich dazu komme, miteinander zu reden, um sie dann mit der Frage zu provozieren, ob sie denn überhaupt wisse, was „reden“ sei. Das Gespräch trotzt den rhetorischen Techniken des Flirts und stellt Sprechakte als gewaltförmige gerade da aus, wo es um vermeintlich bloß objektive Akte der Benennung (von ihrem Geschlechtsteil, von seinem Arbeitsplatz) geht. Das zweite Gespräch, zwischen einem Schriftsteller und einer Schülerin, kreist um pubertäre Sinnsuche, die auf joviale Bonhomie prallt, bis das Mädchen eingeschüchtert feststellt, sie hätte ihre Fragen an den Intellektuellen besser in Briefform gestellt. Auch hier bleibt der Flipperautomat präsent, im Spiegel hinter den beiden reflektiert, und sein Klackern punktiert die holprige Konversation. Die dritte Sprachsituation ist zuerst kaum im selben Café verortbar; allein das aus der Ferne gedämpfte Klingeln des Flipperautomaten verortet die zwei hinter aufgetürmten Bücherstapeln sitzenden Männer. Der eine zitiert aus Büchern und Zeitungen Theoriefetzen und Aktualitäten, während der andere das Gesagte notiert.
Verfremdet werden die Alltäglichkeit soziokultureller Distinktionsversuche, die intellektuelle Pose und Posse, die Liebesanbahnung, das argumentative Übertrumpfen, die Zitateklauberei und Aufschneiderei. Die Situationen werden zu Lehrstückchen über Entfremdung im Sprechen und des Sprechens.
Das kommentiert der Flipperautomat nonverbal aus dem Hintergrund: Nicht einfach Dekor einer Szenerie aus dem Paris der 1960er, ist er dasjenige Ding, das scheinbar in simplem Kontrast zu den Sprechakten steht, weil es dem Prinzip körperlicher Reaktionsfähigkeit gehorcht. Doch tatsächlich ist das Verhältnis von Sprachsituationen und Flipper in 2 OU 3 CHOSES QUE JE SAIS D’ELLE nicht diametral, sondern dialektisch: Der Flipper ist zunächst Überbietung eines sprachlichen Unvermögens; seine Laute sind elektromechanisch und auf eine bestimmte Menge an Tönen begrenzt. Seine Verlautbarungen gehorchen der Ökonomie des Kleingelds im Münzschlitz. Doch gerade in dieser reduzierten Kommunikationsfähigkeit erklingt der Sound des Spätkapitalismus. Dessen Regime der Kommodifizierung erfasst alle sozialen Verhältnisse (deren Facetten der gesamte Film Godards verhandelt): Sozialität hat dann aber ihre wesentliche Form in den Dingen selbst, nämlich als verdinglichte Kommunikationsverhältnisse. In diesem Sinne liest sich Friedrich Heubachs Sprachkritik warenförmiger Dinge wie ein Trailer zu 2 OU 3 CHOSES QUE JE SAIS D’ELLE: „Die Dinge haben ihr [d.i. die Sprache; D.G.] den Rang abgelaufen, sie sind beredter. Ariel, Stuyvesant, schwarze Rosen im Hemd, High Fidelities, Coca Cola, Flipper, Ralley Streifen etc. artikulieren profitabler. Unter den Bedingungen der entwickelten Warenproduktion erscheinen die Worte in ihrer ‚Gratiskultur’ zunehmend anachron, und ihre kommunikativen etc. Funktionen werden den Dingen übertragen, in deren ‚Wertnatur’ dann der Schlüssel zur Kommerzialisierung auch der Kommunikation liegt: die Dinge sind – anders als Worte – Zeichen mit Wert. Sie transportieren mir die Bedeutungen nicht mehr für nichts, sondern nur noch gegen bar.“ (Heubach 1972: S. 241) „Kurz: Von der Sprache als sprechender Sprache zu reden ist romantisch. Zu reden wäre von den Dingen als vielsagenden.“(Ebd.: S. 243.) Nicht Wortschöpfung, vielmehr Wertschöpfung. Der Flipperautomat bei Godard ist als ein solches Ding – anders als bei Truffaut – nicht Refugium gegen herrschaftliche Subjektivierungspraktiken, sondern verdinglichte Kommunikation, was er gar nicht erst verbrämen kann. In Analogie zu Roland Barthes’ Text zu Arthur Adamovs Drama Le ping-pong (1955), in dessen Zentrum ein Flipperautomat steht, lässt sich auch für den Flipper in 2 OU 3 CHOSES QUE JE SAIS D’ELLE sagen, dass er nicht symbolisch zu verstehen ist: „Er ist wörtlich zu nehmen, und seine Funktion ist es, gerade kraft seiner Objektivität Situationen zu erzeugen. [...] Diese Situationen sind nicht psychologischer Natur, sie sind in ihrem Wesen Sprachsituationen.“ Auch der Flipper bei Godard hat an den Sprachsituationen im Café insoweit Anteil, als dass er dort der sichtbare und hörbare Ausdruck der im Spätkapitalismus verdinglichten Kommunikation ist, von der die Worthülsen noch nicht wissen. In gewisser Ähnlichkeit zu Adamov handelt es sich in den Sprachsituationen bei Godard um eine „entliehene Sprache, die immer ein wenig innerhalb der Karikatur liegt, allgemein ist“. (Barthes 1964: S. 51) Im Unterschied zu jenem Sprechen aber ist das erkaufte Klingeln und Rattern des Automats dann historisch wahrhaftig.
Hat der konkrete Flipper bei Godard seinen Platz im Café, streut er auch in die Filmbilder der Großstadt von 2 OU 3 CHOSES QUE JE SAIS D’ELLE aus, ja, er wird sogar zu deren kompositorischen Folie: Die Aufnahmen der neuen Stadtautobahnen und ihrer spiralförmigen Auffahrten, ebenso die bunten Schriftzüge der im Film omnipräsenten Werbeplakate und Firmenschilder und nicht zuletzt die gekippte Kameraeinstellung eines Wohnhausriegels – sie zusammen machen das filmische Paris: flipperesk.
Übersetzt werden Elemente des Flipperautomaten – Rampen, Bumper, abfallendes Spielfeld, farbig blinkende Felder, auffällige typografische Elemente – in ein filmisches Bild der modernen, vergesellschafteten Stadt. Nicht ganz unähnlich ist dies Guy Debords Bildpraxis von CRITIQUE DE LA SÉPARATION (F 1961):
Zwischen Found Footage-Material (z. B. Wochenschauberichte), das urbane Szenen, Polizeigewalt und anderes zeigt, ist vogelperspektivisch das Spielfeld eines Flippers montiert. Wo hier die Perspektive immersiv funktioniert, korrespondiert sie den Luftaufnahmen von Paris, die in Debords Film wiederkehren: Straßenzüge und -kreuzungen, Plätze, Boulevards und Flussläufe zeigen die Metropole als komplexe, regulierte wie regulierende Anordnung, die nur noch auf eine silberne Kugel zu warten scheint. Deren Lauf wäre nicht gänzlich vorhersehbar, sondern immer auch zufällig. Im Flipper und in der Metropole sind sich Struktur und Kontingenz keine Gegensätze.27
Dass der Flipperautomat solche Übersetzungen und Übertragungen in das Stadtbild erfährt, führt noch einmal zurück ins Café von 2 OU 3 CHOSES QUE JE SAIS D’ELLE: Mit der Repräsentationstradition des Flippers wird dort gebrochen, weil an ihm eine reife Matrone und kein Jüngelchen spielt. Nicht nur durch sein die Gespräche unablässig kolorierendes Klackern, auch durch diesen ikonografischen Kontrapunkt verlautbart sich der Flipper. Doch ist dies nicht nur eine Geschlechterstereotype am Flipper konterkarierende Setzung; es versteckt sich auch ein filmhistorisches Zeichen darin, das selbst auf eine Sprachsituation verweist: Die ältere Flipperspielerin ist Helen Scott, Dolmetscherin in den Interviews von Truffaut mit Alfred Hitchcock für das 1966 erschienene Buch Hitchcock/Truffaut. Hinübergeblinkt wird von Godard zur Nouvelle Vague, als wollte sich Truffauts Wort von deren einzigen Gemeinsamkeit, nämlich dem Faible fürs Flippern, noch einmal bewahrheiten.
Devianz
Verbindet sich mit dem Flipperautomat im französischen Kino der 1950er und 60er Jahre ein Refugium im widerständigen Sprachlosen (Truffaut) oder aber verdinglichte Kommunikation (Godard), zeichnet ihn im amerikanischen eine andere Zeichenhaftigkeit aus. Zeithistorischer Hintergrund mag das Verbot dieses Unterhaltungsspielautomaten in vielen amerikanischen Bundesstaaten zum Teil bis in die 1970er Jahre sein (vgl. Reynolds 2010), was zu Razzien in Spiellokalen und der Konfiszierung von Flippern führt. Entsprechend ist der Flipper im amerikanischen Film häufig mit sozialer Devianz assoziiert.
Ein frühes Beispiel ist der running gag eines an der pinball machine geschickten Truckerfahrers in THEY DRIVE BY NIGHT (USA 1940), der mit verzweifelter Grimasse dennoch ein Pechvogel ist, weil er vor lauter Freispielen und deswegen verspäteter Lieferungen beinahe dreimal seinen Job verloren hätte.
Wird hier Spielsucht komödiantisch aufbereitet, konturiert der Automat in Max Ophüls’ den American Dream torpedierendem CAUGHT (USA 1949) die Egomanie eines kaltherzigen, exzentrischen Millionärs. In dessen viktorianischem, holzvertäfeltem Protzbau ist der Automat das einzige moderne Mobiliar, dem er bei einem Herzanfall fast zum Opfer fällt: im Taumel reißt er die pinball machine um, und sie stürzt auf ihn wie ihm auch seine zynischen Ränkespiele auf die Füße fallen.
Der Automat in CAUGHT – wie auch in THEY DRIVE BY NIGHT – ist noch einer ohne die im Deutschen namensgebenden Flipperarme, die das erste Mal 1947 eingebaut werden; sein auffälligstes Merkmal ist, dass er dort als Luxusobjekt in einem Privatraum steht.
Ganz anders die verranzten Bars, in denen Flipperautomaten im Kontext von Sexualdelikten auftreten – in ANATOMY OF A MURDER (USA 1959) und THE ACCUSED (USA 1988). Zeichnen sich beide Film dadurch aus, juristische und gesellschaftliche Debatten zu Vergewaltigung zu flankieren und wird im filmhistorischen Vergleich die fortgeschrittene Delegitimierung sexueller Gewalt deutlich, ist hingegen die Kontinuität der Konnotation des Flipperautomaten bemerkenswert. In ANATOMY OF A MURDER steht der Flipper „World Champ“ am Tatort des aufzuklärenden Mordes:
Ohne dass er mit dem Verbrechen im unmittelbaren Verhältnis stünde, hat der Flipper eine unheilvolle Präsenz, er ragt aus dem Hintergrund einer sonst kargen, heruntergekommenen Spelunke heraus. Der Flipper ist hier Zeichen whitetrashiger Kultur. Unterstrichen wird das Spielgerät als zwielichtiges Objekt durch die Auskunft derjenigen Frau, die mutmaßlich Opfer einer Vergewaltigung wurde, ihre allerliebste Freizeitbeschäftigung sei Flippern, später kommentiert durch die Ermahnung des Anwalts, sie solle sich in Zukunft gefälligst von „men, juke joints, booze, and pinball machines“ fernhalten.
Seine Statistenrolle bei Otto Preminger schlägt 30 Jahre später in THE ACCUSED zum tatsächlichen Schauplatz einer Gewalttat um. Die in Premingers Film latente Devianz des Flipperns wird explizit. Wo in ANATOMY OF A MURDER weder das Verbrechen noch das Flippern gezeigt werden, präsentiert in THE ACCUSED ein sehr langer Rückblick die Geschehnisse in der schäbigen, am Ortsrand und unter einer hoch aufragenden Highwaybrücke liegenden Bar The Mill. THE ACCUSED setzt deren Hinterraum mit Flippern, Billardtisch, Videospielautomaten und Jukeboxen als anrüchiges Ambiente in Szene. Die chauvinistische Stimmung in der Kneipe wird bis zu ihrem gewaltsamen Ende dekliniert: Spielt Jodie Foster gerade noch ausgelassen und sexy am Flipper – dem Modell „Slam Dunk“, dessen Frontscheibe mit einer halbnackten Frau in einem Basketballkorb sexistisch aufmacht –, wird sie später auf dessen Spielfeld gedrückt und von drei Männern vor einer johlenden Schar brutal vergewaltigt.28
Die Kamera nimmt dabei immer wieder den Blick der Frau ein und vermittelt beklemmend ihr Ausgeliefertsein. Das vorherige ruppige, obsessive und sexualisierte Flippern der Männer bereitet motivisch diese Vergewaltigung vor; der Körper der Frau wird dem Automat gleichgesetzt.29 Mit Roland Barthes lässt sich hierin ein grundsätzliches maskulinistisch-sexualisiertes Strukturelement des Flipperspiels erkennen: „Der [...] Spielautomat unterhält eine Symbolik der Penetration: Es geht darum, mit einem gut geführten ‚Stoß’ das Pin-up-girl zu besitzen, das da lachend und erwartungsvoll auf der Rückentafel leuchtet.“ (Barthes 1981: S. 46)
Schwabing
Bei aller gebotenen Skepsis gegenüber der Einteilung in Nationalkinematografien besticht die Divergenz des Motivs des Flippers im französischen und amerikanischen Kino. Zu ihnen verhält sich der Neue Deutsche Film der 1960er und 70er Jahre als Vermischung.
Sowohl in LIEBE IST KÄLTER ALS DER TOD (BRD 1969) als auch in SUMMER IN THE CITY (DEDICATED TO THE KINKS) (BRD 1970) ist das Flipperspiel Teil von Gangstergeschichten. Fassbinder macht an der Wand aufgereihte Flipperautomaten zum Schauplatz eines konspirativen Treffens. Die Kameraeinstellung der nebeneinander flippernden Männer lässt das Pissoir assoziieren.
Bei Wim Wenders steht Hanns Zischler verloren und stoisch im Hinterzimmer einer Kneipe, wo ihn die unbewegte Kamera lange beim Flippern zeigt, während Roy Black aus der Musicbox ertönt; unterbrochen wird das Spiel nur, wenn Zischler den Fensterverschlag zu einem Münchner Hinterhof mit strolchenden Kindern öffnet.
Der Flipper wird später in Kontrast zum Billardtisch gesetzt, an dem Zischler und Wenders selbst schier endlos mit den Queues hantieren. Das Billard hat, trotz Spelunke, einen seriöseren Anstrich, stiftet zwischen Schauspieler und Regisseur eine wortlose, gleichberechtigte Interaktion und ruft überdies ein älteres, reiferes männliches Initiationsritual auf, glaubt man der generationellen Unterscheidung, die Marshall Frady trifft: „[O]ne of the common events in the private unarticulated history of my own generation, growing up during the Fifties in the fluorescent beginnings of the shopping-center civilization, was that we tended to come by those rude musks of experience by way of playing pinball machines – much as poolrooms once served the boyhood seasoning of our fathers“ (Frady 1972: S. 159); „it was not pool tables but pinball machines that acted, obliquely, as the medium of translation out of that nebulous [...] boyhood.“ (Ebd.: S. 164)
Sowohl bei Wenders wie bei Fassbinder zieht der Flipper weitere Kreise, als ein filmisches Motiv zu sein. Der Automat wird schon in Wenders’ erster Filmarbeit verwendet – nicht als Objekt, sondern strukturgebend: SAME PLAYER SHOOTS AGAIN (BRD 1967), der im Titel eine gängige Instruktion an den Flipperspieler zitiert, wiederholt fünfmal die identische Kamerafahrt, die einen angeschossenen, strauchelnden Mann zeigt, der eine Maschinenpistole mit sich schleppt. In der ursprünglichen Fassung variieren die Sequenzen, indem sie verschieden koloriert sind; die fünffache Wiederholung der selben Sequenz wiederum basiert auf der in den 1960ern geläufigen Anzahl von Flipperkugeln pro Spieler. In SAME PLAYER SHOOTS AGAIN überlappen sich der Flipper und das Schießgewehr, um da schon eine juvenile bundesrepublikanische Angstlust am waidwund geschossenen Stadtguerillero als popkulturellen Topos vorwegzunehmen.30
Auch Fassbinders Leidenschaft fürs Flippern artikuliert sich dezidiert politisch; sie steht für die Ablehnung bourgeoiser Lebensformen ein: In einem Gespräch mit der Filmkritik, das die Produktion von LIEBE IST KÄLTER ALS DER TOD diskutiert, wird Fassbinder nach einem möglichen Zusammenhang seiner Film- und Theaterarbeiten zum Sozialismus gefragt, was er nicht nur mit der praktizierten Politisierung des Privaten bejaht,31 sondern auf die eigentümliche Nachfrage – „Und da gehören also auch Flipper dazu, und so weiter?“ – erwidert: „Logisch gehören Flipper dazu. Da gehören Flipper dazu und gehören lauter Dinge dazu, die Spaß machen. Wenn ich gerne Flipper spiele, kann damit niemand was anfangen. Aber wenn ich jemand so gerne mag, daß ich ihn heirate, das ist dann schon wieder benutzbar.“ – „Was heißt benutzbar?“ – RWF: „Ich heirate jemand, dann habe ich ein Verantwortungsbewußtsein, folglich muß ich arbeiten, weil ich für jemand mitarbeiten muß oder umgekehrt, und dadurch bin ich in einem Prozeß drin.“ [...] RWF: „Ich spiele zum Beispiel auch viel lieber Flipper allein als mit anderen Leuten.“ (Ebd.: S. 475)32 Die Idee vom Flipper als halb lustigem, halb ernst gemeintem emanzipatorischen Gegenentwurf zu Eheschließung und Reproduktionsparadigma erfährt in einer Arbeitsnotiz Fassbinders von 1971 eine trotzig entschlossene Traurigkeit: „Einer, der eine Liebe im Bauch hat, muß nicht am Flipper spielen, weil eine Liebe schon genug mit Leistung zu tun hat, daß man die Maschine nicht braucht, gegen die man doch nur verlieren kann. [...] [D]ie Vorstellung von einer schönen Liebe ist eine schöne Vorstellung, aber die meisten Zimmer haben vier Wände, die meisten Straßen sind gepflastert, und zum Atmen brauchst Du Luft. Ja – die Maschine ist ein perfektes Ergebnis des Kopfes. Ich habe mich entschlossen, ich spiel wieder Flipper und laß die Maschine gewinnen, egal – der letzte Sieger bin ich.“ (Fassbinder 1971: S. 25) Gegen die Maschine, gegen den Flipperautomaten zu verlieren, ist angebrachter, ist immer noch besser, als in die Maschinerie kleinbürgerlicher Liebe zu geraten. Dem Surrogat romantischer Liebe wird die Wahrhaftigkeit des einsamen Flipperns vorgezogen.
Giant Balls
Die angeführten Filme aus den 1950er, 60er und frühen 70er Jahren sind sich zumindest darin ähnlich, dass der Flipperautomat zumeist kein zentrales Thema ist. Dagegen richtet der wahrscheinlich bekannteste Flipperfilm, eine Adaption der gleichnamigen Rockoper von The Who, TOMMY (GB 1975), seinen gesamten Plot auf das Flippern aus.
Der Film spitzt einen bestimmten Topos des schon beschriebenen filmischen (und auch theoretischen) Flipperdiskurses zu, nämlich den zur nonverbalen Kommunikation, wenn er den jeglicher verbaler (und visueller) Kommunikation unbefähigten Tommy allein beim Flippern sein Glück finden lässt.
Der durch ein Trauma stumm, taub und blind gewordene Tommy findet in einem auf der Schrotthalde aufgebahrten Flipperautomaten Trost – und erweist sich wundersamerweise als genialer Spieler, der bald zum Star wird. Seine Fingerfertigkeit hat sich von den kategorisierten Sinnen völlig emanzipiert. Ein ähnliches somatisch-instinktives Flippern beschreibt Marshall Frady in seiner Hymne auf das Spiel: „It was, along with everything else, most assuredly a gently dynamic intercourse of kinetics, involving a fine elegance of watchwork movements, thoughtless subtle reactions, a body wit of discreet and infinitely varied syncopations.“(Frady 1972: S. 164)33
Wo er ein derart wichtiges Element der Diegese ist, ist der Film vor das Problem der Visualisierung des Flipperns gestellt. Sind in anderen Filmen meistens Halbtotale der Spieler_innen am Automaten und Nahaufnahmen des Spielfelds zu sehen, setzt TOMMY hingegen auf groteske Szenografie. Wenn Tommy im Showdown den Pinball Wizard (Elton John) niederringt, findet der Wettstreit vor Publikum auf einer Bühne statt, auf der zwei Flipperautomaten aufgestellt sind.
Doch ist das Spiel vermischt mit einem Rockkonzert,34 große Leuchttafeln blinken schrill kaum nachvollziehbare Punktestände. Das einsame Spiel am Automaten wird zu einem simultanen Wettbewerb, so als spielten die beiden gegeneinander (wie etwa beim Tennis). Zwar zeichnet das Groteske TOMMY ästhetisch, narrativ und thematisch überhaupt als Mittel aus, doch wirkt das Flippern in direkter Konkurrenz und vor Zuschauer_innen in besonderem Maße absurd. Den Kick des herkömmlichen Flipperns muss der Film ins große szenische Arrangement eines massenkulturellen Events übersteigern. Zur selben Ästhetik greift auch das Setting des Finales, wenn Jünger_innen des von Tommy gegründeten Hybrids aus Sekte, Selbsthilfegruppe und Freizeitcamp revoltieren und die massenhaft aufgestellten Flipper zertrümmern. Werden die Spielgeräte maschinengestürmt, dominieren schon zuvor Unmengen riesiger, aufeinander getürmter Kugeln die Szenerie, als wollten sie die Giant Pool Balls Claes Oldenburgs vorwegnehmen.35 Als größenwahnsinniges Dekor machen sie die Zerstörung der Flipper zu einer lächerlichen Geste, weil die Flipperkugeln den Automaten schon entwachsen scheinen. Wo TOMMY den Flipper überdeutlich zum zentralen Thema macht, kippt die filmische Darstellung aus der Präsentation der bloßen Automaten hinaus. Die komplementäre Konzeption zeichnet Wayne Sourbeers Experimentalfilm MONTAGE V: HOW TO PLAY PINBALL (USA 1963) aus, der mit schnellen Schnitten, Überblendungstechnik und einem Soundtrack, den die Komponistin Jean Eichelberger Ivey mit der Bearbeitung aufgenommener Flippersounds besorgt, die Automaten in genuin filmische Ästhetiken übersetzt.
Umgekehrt markieren die gigantischen Vergrößerungen des Flippers und die Fantastik seiner Spielkultur in TOMMY den historischen Zenit der filmischen Präsentationen des Automaten.
Hieran schließen zwei andere Filme mit nostalgischem Blick an: Überdeutlich ist dies in Richard Linklaters Historienfilm DAZED AND CONFUSED (USA 1993).36 Die Spielothek einer texanischen Provinzstadt Mitte der 1970er Jahre ist zentraler Anlaufpunkt, wo Jugendliche zum Ende des Schuljahres abhängen.
Der filmische Blick aus den 1990ern wird zu einem musealen, wenn alle möglichen Spielgeräte vergangener Freizeitkultur nebeneinander wie Ausstellungsobjekte aufgereiht sind. Den Gegenpol dazu bilden Nahaufnahmen der rollenden Flipperkugel und der Flipperarme: Eben diese Bilder sehnen die Überwindung der historischen Distanz herbei, sie versprechen im Close-up das immersive Jetztsein im Spiel und im Vergangenen.
Dass Linklaters Film nostalgisch ist, macht die zeitliche Differenz. Doch schon TILT (USA 1979) ist ein leiser Abgesang auf die Flipperkultur.
Anders als in den ästhetischen Überzeichnungen und Gigantismen von TOMMY kehren noch einmal Nahaufnahmen von Flipperspielfeldern, Spielständen und rollenden Kugeln wieder. Mit den heruntergekommenen, tristen arcades in Atlantic City und anderswo kündigt TILT aber den bald beginnenden massenkulturellen Niedergang des Flippers schon an. Und wenn am Ende ein videotechnisch eingeblendetes „Game Over“ den Film beschließt und eben kein von zu starkem Geruckel verursachtes „Tilt“ aufleuchtet, erklingt geradewegs schon der Jargon der Computerspielkonsole.
Noch auf andere Weise bricht TILT mit der filmischen Geschichte des Flippers: Im Mittelpunkt steht eine junge, weibliche Meisterin des Flipperns, die mit Wettspielen ihr Einkommen macht. So schert TILT – gleichzeitig der Spitzname der 14-Jährigen, die von Brooke Shields gespielt wird – aus der maskulinistischen Bildtradition des Flipperns aus,37 auch wenn auf ihren hinteren Hosentaschen blickfängerisch und frivol „Pinball Champ“ aufgenäht ist. Ihrem öfters als hustler titulierten Kompagnon kann sie am Ende nicht zu männlicher Attitüde verhelfen („She can’t win your balls for you, son“), und der Film verbindet damit ihre zumindest latente Emanzipation.
Exkurs: Sängerinnen und Flipper
Sind Brooke Shields und TILT, sind weibliche Automatenspielerinnen im Film überhaupt die Ausnahme, verhält es sich in der Musik anders. In den meisten der angeführten Filme steht dem Flipper „un frère siamois mécanique“ (Virno 1998: S. 82) zur Seite, die Jukebox.38 Diese räumliche und kulturelle Nähe von Musik und Flipper zeigt sich auch an einem anderen Ort, dem Musikclip. Dort ist das Thema des Flippers auffallend mit Frauen verbunden. Über vier Lieder und Clips lassen sich historische Verschiebungen feststellen, die die Geschlechterverhältnisse betreffen.
Le Billard électrique von Edith Piaf handelt von einem jungen Mann in der Kneipe, der vergebens auf seine Verabredung wartet und sich die Zeit am Flipperautomaten vertreibt. Die Liedzeilen, die sich dem Flippern widmen, singt und brüllt Piaf in großer Gehetztheit, eingeholt wird mit onomatopoetischen Wörtern Geklingel, Geschrille und Zählerstand: „Ding ! Cent mille ! Ding ! Ding ! Deux cent mille ! Trois cent ! Quatre cent ! Cinq cent mille ! Ding ! Ding ! Ding ! Re-ding ! Ding ! DING !... TILT !!!“ In einem Filmmitschnitt eines Konzerts von 1962 im niederländischen Nijmegen ahmen Hände, Arme und vor allem Daumen Piafs das Abschießen der Flipperkugel und das Drücken der Knöpfe nach.
Chantal Goya – die, wie beschrieben, in MASCULIN FÉMININ mitwirkt – droht in Si tu gagnes au flipper von 1966 – geschlechtlich komplementär zu Piafs Chanson – einem Typen mit dem Entzug ihrer Liebe: „Si tu gagnes au flipper, tu as perdu mon cœur.“ Im Filmclip zum Lied wird Goyas Name typografisch wie der Name eines Flippermodells präsentiert; zwischen den Wörtern sind ihre Augen ins Bild eingefügt.
Diese Geste wiederholt sich im Clip mit der Ansicht verschiedener Flipperfrontscheiben, durch die ihre Augen blinken. Außerdem wird das Splitscreenverfahren eingesetzt, wenn Goya singt und neben ihr die Nahaufnahme eines Bumpers auf dem Flipperspielfeld zu sehen ist, an den die Kugel prallt. Diese Bildpraxis hat nichts von den sexualisierten weiblichen Motiven auf Flipperautomaten, stattdessen schreibt sich im Wortsinn ein weiblicher Blick in den Automaten ein.
Eine emanzipatorische Wende nimmt das Motiv der Flipperkugel in Corynne Charbys Popsong Boule de Flipper (1986). Nicht dem Boy wird nachgeweint, das Girl besingt sich selbst als Flipperkugel: „Je vis comme une boule de flipper qui roule“.
Im Musikvideo treibt sich Charby in einer Spielhalle herum; sie flippert dort, aber das Motiv der Kugel wird auch in anderen Spielen gefunden, beim Billard und Bowling. Charby hantiert zudem mit einer großen silbernen Kugel; die Flipperkugel, der sie sich im Liedtext gleichmacht, würde in der filmischen Visualisierung zu winzig ausfallen.
Dementgegen vergrößert das Musikvideo zu No Limits! (1993) den Flipper:
Sängerin und Rapper der Kirmestechnokombo 2 Unlimited tanzen im überdimensionierten Flipperspielfeld mit Bumpern und Targets aus Plastik, Glanzfolie und Pappmaché. Montiert mit Bildern eines Spielers und eines blinkenden Automaten findet die Kugel im Nachbau des Flippers ihre Entsprechung zum einen in der ruckhaften Kamera, zum anderen in der Sängerin selbst, die in ihrem silbernen Outfit in einigen Einstellungen auf einer Vorrichtung vor der Kamera steht und auf diese Weise durch den Raum bewegt wird. Der Liedtext von No Limits! hingegen enthält kein Flipperthema: „Hard to the core, I feel the floor / When I'm on stage, yo, ya answer more / I'm on the edge, I know the ledge / I work real hard to collect my cash! / Tick tick ticka tick take your time / when I'm goin' I'm goin' for mine“. Besungen wird die Selbstverwirklichung durch die Musik, erklingen tut eine Hymne grenzenloser, erschöpfender und gerade darin lustvoller Kreativarbeit im Neoliberalismus. Das Video zu No Limits! verhält sich affirmativ zu dieser neuen Ökonomie, wenn die Subjekte, in den großen Flipperautomaten katapultiert und Flipperkugeln gleichgemacht, (anders als bei den flipperhaften und kapitalismuskritischen Stadtansichten Godards und Debords) ihre eigene Handlungsohnmacht nicht unfröhlich stimmt. Eine von Paolo Virno erinnerte revolutionäre Parole aus den 1970ern – „[D]ans la civilisation du flipper et de l’usine fordiste, un slogan disait : « être à l’intérieur (de l’usine) et contre »“39 – wird in No Limits! Anfang der 1990er insofern umgekehrt, als dass das Eingeschlossensein im Automaten nicht zum Kampf, sondern zum Herumhüpfen führt.
2. Flipper, Kino, Materialismus
Die versteckte Botschaft im Video zu No Limits! lenkt den Blick verstärkt auf die mögliche politische Relevanz des Flippers.40 Wo der Film seit den 1950er Jahren schon längst Diskurse zum Flipper gestiftet hat, kündet vor allem ein Text von Bernd Jürgen Warneken aus der schmalen Theoriegeschichte des Flippers der 70er Jahre von einer noch anderen Beziehung zum Kino: Diese zielt nicht auf einzelne Filme ab, sondern konzipiert die Erkenntnisobjekte von Kino und Flipper als strukturell analoge. Rekurriert wird bei Warneken dabei auf film- und kinotheoretische Positionen Walter Benjamins und Siegfried Kracauers aus den 1920er und 30er Jahren.
Grundsätzlich ist zunächst festzuhalten, dass flippertheoretische Texte von Friedrich Heubach, Dieter Hainz oder eben Warneken „die Flipper-Euphorie in der antiautoritären Phase der [bundesrepublikanischen] Linken“ (Heubach 1979: S. 131) veranschaulichen. Dem Phänomen des Flipperautomaten wird dialektisch-materialistisch, ideologiekritisch und unter dem Eindruck der Kulturindustriethese der Frankfurter Schule begegnet, entschieden positioniert wird sich gegen kulturkonservative und jugendpädagogistische Ressentiments;41 jene Positionen stehen ein Stück weit der Schwarzmalerei eines Roger Caillois entgegen, der das Flippern als „jeux vides“, „jeux nuls“, „pseudo-jeux“ (Caillois 1967: S. 1129) disqualifiziert.
Ausgehend vom Umstand, dass der Großteil von Flipperspielern nicht nur männlich ist, sondern hauptsächlich aus jungen Arbeitern, Schülern und Studenten besteht, analysiert die Ideologiekritik über solche Sozialemperie hinaus den strukturellen Bezug des Flippers zu kapitalistischen Arbeitsverhältnissen: Dem Flipper wird die Wiederholung spätkapitalistischer, fordistisch-tayloristischer Fabrikarbeit attestiert (vgl. Warneken 1974: S. 107), weil hier die „Automatisierungselemente den Unterhaltungsinhalt selbst bilden“. (Ebd.: S. 85.) Die Freizeit arbeitet den Produktionsverhältnissen reproduktionslogisch zu. „[A]ls Maschine verbindet er akustische und visuelle Erfahrungen aus der Produktionssphäre mit den unendlich zu variierenden und verfeinernden Aktionen und Techniken des zweck- und gewinnfreien Spiels mit der Kugel.“(Ebd.: S. 23) Doch die spielerische Tätigkeit „gewinnt kein von ihr erlösendes Produkt, sondern nur ein Zeichen ihrer Effektivität: Zahlen.“ (Heubach 1979: S. 129.) Das Numerische (ähnlich einer „Registrierkasse“ (Hainz 1970:S. 21)) geht zudem Hand in Hand mit dem Erotischen, wie es sich oftmals in der massenkulturellen Ornamentik der Flipperfrontscheiben findet und seine Entsprechung wiederum in industrieller Arbeit hat: „Die Glamour-Girls treten oft gleich in Kolonnen auf, Zahlenreihen balancierend oder im Tabellenkostüm. Kaum schöner könnte man den Satz Kracauers illustrieren: ‚Die Beine der Tiller-Girls sind die Hände in der Fabrik.’“ (Ebd.: S. 23) Muss die Physis des Spiels – egal welcher Finesse – der Logik des Automaten folgen und mag eben der Fabrikarbeit am Band ähneln,42 soll das Flippern trotzdem nicht allein deren schlichte Wiederholung, nicht allein deren Abziehbild sein, sondern schafft mit der Möglichkeit zur Aggression im Spiel (vgl. Warneken 1974: S. 96) auch Kompensation gegenüber der Erfahrung in der Arbeit. Doch tauge das Flippern trotzdem nicht als „sedative Gegenerfahrung zur kapitalistischen Alltagspraxis“ (ebd.: S. 121), weil es noch erfahrungsärmer und gänzlich unproduktiv sei. So konstatiert Warneken, „daß das Spiel weder Konzentration noch Entspannung bedeutet, weder geistige oder körperliche Fähigkeiten ausbildet noch übermütiges Allotria, einfaches Sichgehenlassen erlaubt.“ (Ebd.) Doch aus dialektisch-materialistischer Perspektive schlägt die Analogiebildung von Flippern und industriekapitalistischen Arbeitsverhältnissen gerade dadurch in Erkenntnis um, weil „es in seiner Repetitivität und Ungemütlichkeit, seiner Roheit und Ungeselligkeit so gar nicht dem Programm entspricht, in der Freizeit über die Probleme des Alltags den Schleier des Vergessens zu breiten.“ (Ebd.) Noch darüber hinaus will Heubach in der Lust beim Flippern einen vagen emanzipatorischen Horizont ausmachen: „Sicher exerziert die Wirklichkeit im Flipper Illusionen, aber die können zu Ansprüchen werden, – sicher exerziert sie in ihm ziemliche Fatalismen, aber die könnten sich zu Freiheiten auflehnen, – sicher exerziert sie im Flipper ein Status-quo-erhaltendes Lavieren, aber das könnte die Schule der List sein“. (Heubach 1979: S. 131)
Auf solch einer dialektisch-materialistischen Folie begegnet im akribischsten und gewieftesten Text – in Warnekens „Der Flipperautomat. Ein Versuch über Zerstreuungskultur“ von 1974, der auch unter Einbezug quantitativ-sozialempirischer Studien, Diskursanalyse von Spielautomatenfachzeitschriften und -werbebroschüren und kulturanthropologischer Feldforschung zu einer ausladenden Darstellung kommt –, dort also begegnet der Flipper immer wieder Vergleichen zum Kino. Für eine dialektisch-materialistische Kulturkritik wird der Flipper deswegen zum Gegenstand, weil er sich auf der Höhe gesellschaftlicher Verhältnisse in den Industriestaaten der 1970er Jahre befindet – so wie es für das Kino vor allem in der ersten Jahrhunderthälfte gilt.
Produktionsästhetisch konstatiert nicht nur Warneken, dass das Design der Flipperautomaten versuche, „nicht hinter den [...] vom amerikanischen Film geschaffenen Mythen zurückzubleiben“. (Warneken 1974: S. 87) Auch ohne explizite Filmbezüge steht der Automat ikonografisch in der Tradition des klassischen Hollywoodkinos, weswegen die linke Kulturkritik die Flipperästhetik als altmodisch, ja reaktionär ansieht: „Die in den USA fabrizierten Flipperbilder zeigen eine Welt, die sich auszeichnet durch die naive Eindeutigkeit des Versuchs, ein Surrogat von Reichtum und ‚feiner Gesellschaft’ zu geben. Dazu wird ein Glücksklischee der Hollywood-Produktion der fünfziger Jahre gegeben, das in seiner Starre und Gefrorenheit dem heutigen Ideal [d.i. dasjenige der frühen 1970er Jahre; D.G.] der Spieler nicht mehr entspricht.“ (Meistermann-Seeger/Bingemer 1971: S. 50)
Bei Warneken indes nimmt der rezeptionsästhetische Vergleich von Flipper und Kino wesentlich breiteren Raum ein. Geräuschkulisse und visuelle Effekte des Flippers ähnelten „Unterhaltungsmittel[n], welche die Apperzeptionsfähigkeit vor allem durch elektrisch ausgelöste Erscheinungen in mehrfacher Weise beanspruchen“. Das, was der Flipperspieler wahrnehme, erinnere „an die Addition von ‚sounds, lights und action’ in der Beat- und Popmusik ebenso wie an Filme mit rascher Schnittfolge und speziell den Trickfilm, welcher als Kombination von Bewegungs- und Lauteffekten in wechselndem Schnittrhythmus dem Zuschauer einem Wechselbad von Eindrücken – wenn auch nicht Tätigkeiten – verschiedenen Tempos aussetzt.“ (Warneken 1974: S. 104 f) Warneken subsumiert den Flipper demzufolge jenen Unterhaltungsmedien, deren Form die „Chockapperzeption“ ist.
Den Begriff des Chocks entlehnt Warneken Walter Benjamin, wie er in „Über einige Motive bei Baudelaire“ (Benjamin 1939: S. 201-245) und in „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ (1936/1938) im Zusammenhang der Beschreibung und Analyse moderner Subjektivität entwickelt und nicht zuletzt auf den Film gemünzt ist: „Was am Fließband ein Rhythmus der Produktion bestimmt, liegt beim Film dem der Rezeption zugrunde.“ (Ebd.: S. 221) Im Kunstwerkaufsatz heißt es: „Der Film ist die der gesteigerten Lebensgefahr, der die Heutigen ins Auge zu sehen haben, entsprechende Kunstform. [...] Der Film entspricht tiefgreifenden Veränderungen des Apperzeptionsapparates – Veränderungen wie sie im Maßstab der Privatexistenz jeder Passant im Großstadtverkehr, wie sie im geschichtlichen Maßstab jeder heutige Staatsbürger erlebt.“ (Benjamin 1936/38: S. 39) Bei Benjamin tritt der Film als Kultur der Masse an, die Apperzeption von Chocks einzuüben;43 er tut dies maßgeblich im Modus der Zerstreuung: „Durch die Zerstreuung [...] wird unter der Hand kontrolliert, wie weit neue Aufgaben der Apperzeption lösbar geworden sind. [...] Die Rezeption in der Zerstreuung, die sich mit wachsendem Nachdruck auf allen Gebieten der Kunst bemerkbar macht und das Symptom von tiefgreifenden Veränderungen der Apperzeption ist, hat am Film ihr eigentliches Übungsinstrument. In seiner Chockwirkung kommt der Film dieser Rezeptionsform entgegen.“ (Benjamin 1936/38: S. 41)
Warnekens Vergleich von Filmschau und Flippern, die über das Konzept „Chockapperzeption“ verläuft, versteht beide als Entsprechungen der Subjektivierungsprozesse innerhalb industriekapitalistischer Arbeit und urbaner Räume. Doch macht Warneken einen wichtigen Unterschied zwischen Flipper und Kino in den Dimensionen der Rezeptions- bzw. Apperzeptionsfähigkeit aus. „[D]ie Filmrezeption ist, wie die Anfänge des Filmes am deutlichsten zeigten, auch eine Übung darin, ein zunächst als chaotisch wahrgenommenes Ensemble von Eindrücken zum Verständnis eines Zusammenhangs zu biegen; die Unaufmerksamkeit der Rezeption zeigt hier an, daß die Apperzeptionsfähigkeit fortgeschritten ist.“ (Warneken 1974: S. 118 f.) Beim Flippern hingegen seien es Skills, beschränkte Fingerfertigkeiten, die den Spieler auszeichneten: „Die Kontemplativität ist, obwohl der Spieler hier körperlich eingreift, letztlich größer als bei der Filmrezeption, da diese eine ständige nervliche und geistige Neueinstellung erfordert, während der Flippernde nur eine mechanische Handbewegung repetieren kann, die spielbegleitenden optischen und akustischen Eindrücke aber weder einen Sinnzusammenhang bilden noch das Vergnügen vielfältiger sinnlicher Wahrnehmung erlauben. Dem Flippernden gelingt weder die Versammlung des Zerstreuten durch größere Geistesgegenwart noch die, nach Benjaminscher Terminologie, zerstreute, d. h. unaufmerksame Bewältigung dessen, was ihm bleibt: des Flipperschlags.“ (Ebd.) Der aufgebrachten Aufmerksamkeit und Anspannung steht die grundlegende Simplizität des Flipperspiels – die Kugel soll die Fläche nicht verlassen – im Unverhältnis gegenüber. Im Unterschied zu Benjamins Ausrichtung des Chock-Begriffs – und in gewisser Nähe zu Truffauts LES QUATRE CENTS COUPS – attestiert Warneken dem Flipper eine tendenziell eskapistische Funktion: „Die Chocks im Spiel wären demnach dazu da, den ungleich inhaltlicheren der Realität zu entkommen, oder anders ausgedrückt: Wer am Flipper dem Gehalt der alltäglichen chokhaften Erfahrungen entgehen will, unterwirft sich dafür der Gestalt dieser Erfahrung. Zerstreuung hieße hier nichts anderes als die momentane Dekomposition des Individuums, um der anstürmenden Tagesproblematik kein Ziel mehr zu bieten.“ (Ebd.: S. 120)
Im Weiteren vertieft Warneken den Begriff der Zerstreuung, den er zunächst von Benjamin übernimmt, im Anschluss an Siegfried Kracauer, wo er eine tendenziell andere Richtung nimmt. In „Kult der Zerstreuung“ von 1926 ist Zerstreuung zentraler Begriff im Verständnis vom Kino als maßgeblichem Ort für die Erkenntnis gesellschaftlicher Zustände. Kracauer deckt in der Zerstreuung der Zuschauer_innen zwar auch die klandestine Einübung kapitalistisch-urbaner Subjektivierungen auf, doch geht es dialektisch bald um den moralischen und politischen Gehalt einer Kultur der Zerstreuung. Bei Kracauer sind die Berliner Kinos der 1920er Jahre „Paläste der Zerstreuung“ (Kracauer 1926: S. 311), die den Zustand von Kultur und Gesellschaft bestimmbar machen. Wo bildungsbürgerlich-idealistische Kulturinhalte den Zerfall bürgerlicher Gesellschaft verbrämten, ist die Popularität des Films laut Kracauer darauf zurückzuführen, dass seine Form den gesellschaftlichen Gegebenheiten entspricht, ja sie aufdeckt: „Das Berliner Publikum handelt in einem tiefen Sinne wahrheitsgemäß, wenn es [...] dem Oberflächenglanz der Stars, der Filme, der Revuen, der Ausstattungsstücke den Vorzug erteilt. Hier, im reinen Außen, trifft es sich selber an, die zerstückelte Folge der splendiden Sinneseindrücke bringt seine eigene Wirklichkeit an den Tag.“ (Ebd.: S. 314 f.) Ähnlich wie später Benjamin beschreibt Kracauer die Filmrezeption als etwas, das sich dem bewussten Nachvollzug versperrt: „Die Erregungen der Sinne folgen [...] so dicht, daß nicht das schmalste Nachdenken sich [...] einzwängen kann.“ (Ebd.: S. 314) Nichts Pejoratives ist jedoch damit verbunden: Die Zerstreuungssucht führt Kracauer zurück auf „die Anspannung der arbeitenden Masse – eine wesentlich formale Anspannung, die den Tag ausfüllt, ohne ihn zu füllen. Das Versäumte soll nachgeholt werden; es kann nur in der gleichen Oberflächensphäre erfragt werden [...]. Der Form des Betriebs entspricht mit Notwendigkeit die des ‚Betriebs’.“ (Ebd.: S. 313f.) Trotz gegenläufiger, restaurativer Tendenzen im Kino, die sich laut Kracauer anstrengen, der Zerstreuung – oberflächlichen, überkommenen Kulturgehalten nacheifernd – Sinn aufzupfropfen, hält die Massenkultur nicht nur dem Theoretiker Erkenntnis bereit. Vielmehr ermächtigt Kracauer das Publikum im Wunsch nach Zerstreuung den Zerfall bürgerlicher Kultur potentiell zu erkennen.
Obwohl Kracauers Thesen zum Zusammenhang von kapitalistischer Arbeit, Zerstreuungskultur und Kino in den 1920er Jahren als dialektisch-materialistisches Vorbild für den Flipper der 70er Jahre geeignet scheinen, distanziert sich Warneken, was eine allgemeine politische Bewertung von Massenkultur anbelangt: Kracauers Implikationen der Zerstreuungskultur erscheinen ihm als weit zu optimistisch, was die potentielle Erkenntnis des Kinopublikums betrifft.44 Ein wesentlicher Grund für die Kritik an Kracauer scheint Warnekens übergeordnete Perspektive auf das Verhältnis von Arbeit und Freizeit zu sein, das nicht in „struktureller Homologie, sondern in einem Funktionsbezug“ (Ebd.: S. 113) stehe. Dementsprechend kann laut Warneken erst die Ablösung kapitalistischer Produktionsverhältnisse die Möglichkeit sogenannter gehaltvoller Unterhaltungsformen bieten. Keineswegs Bildermaschinenstürmerei ist seine Losung, sehr wohl aber die Aussicht auf einen sozialen, d. h. positiv kommunikativen Gebrauch nicht zuletzt des Flippers in einem zukünftig nicht mehr kommodifizierten Sozialen. Die Frage der Kommunikation – und hier schließt Warneken an denjenigen Topos an, der sich durch die filmische Motiv- und Zeichengeschichte zieht – treibt seinen Text im Besonderen um; „Flippern nämlich ist kein Spiel, das – wie Börsenspiele oder Kartenspiele – noch ein halbwegs zusammenhängendes Gespräch oder ein Planen, Nachdenken, Probieren, Unterbrechen gestattete. Es addiert sich aus Handgriffen, die als prinzipiell gleiche im strengen Sinn keine Kontinuität haben.“ (Ebd.: S. 102) Markanterweise verrutscht Warnekens Kritik an der Sprachlosigkeit des Flipperspiels implizit nicht nur hin zur Affirmation der Sprachmächtigkeit bürgerlicher Öffentlichkeit. Unausgesprochen ist das Flippern in seiner (vermeintlichen oder tatsächlichen) Sprachlosigkeit dem Kinobesuch noch einmal ähnlich.
3. Flipper als Filmadaption
In Warnekens dialektisch-materialistischer Theorie des Flippers, wie sie umrissen wurde, spielt die Analyse von Flippermodellen so gut wie keine Rolle. Bei Dieter Hainz – sehr wahrscheinlich ein Pseudonym des Kunsthistorikers Benjamin Buchloh45 – geht es 1970 hingegen um eine marxistisch ausgerichtete kunsthistorische Darstellung zu Plexiglasabdrücken der Flipper, ausgehend von den 1950er Jahren. Die Frontscheiben werden als Spielart amerikanischer Trivialmalerei klassifiziert. Hainz fasst die allgemeinen Grundzüge als in der „Tradition des Jahrmarkts und Zirkus“46 stehend, die sich mit der Ästhetik amerikanischer Konsumkultur vermische. Wiederkehren würden die „Gespenster Schablonenrealismus und Zentralperspektive in der billigen Imitation“, dominant seien „formale[...] Infantilität“ und die Überfülle inhaltlicher „Klischees“ (die nicht zuletzt geschlechtsspezifisch sind). Außer den Bildelementen würden typografisch „Vorbilder der Reklametransparente und Billboards wie die Lichtgraphik der Neonzeichen auf engstem Raum zu Collagen verschiedenster Schrifttypen zusammengefügt.“ (Ebd.: S. 21) Wo amerikanische Produzenten den Markt an Flippern bestimmen, resümiert Hainz seine von der Kulturindustriethese geprägte Studie: „[D]er Screen des Automaten wird zum Guckkasten der Exportbilder des American Dream.“ (Ebd.: S. 23)47
Im Unterschied zu dieser überblickhaften Perspektive auf Flippermodelle legt Michael Oppitz mit seinem Text Semiologie eines Bildmythos. Der Flipper Shangri-La die Untersuchung eines spezifischen Flippermodells vor. Der zuerst 1974 auf französisch in Claude Levi-Strauss’ Zeitschrift L’Homme erschienene Aufsatz (vgl. Oppitz 1974: S. 59-83) widmet sich den Bezugnahmen auf tibetische, chinesische und japanische Mythen und Bildtraditionen wie deren Transformierungen durch westliche, kulturindustrielle Fortschreibungen. Im Mittelpunkt steht der Mythos eines in asiatischen Kulturen tradierten, paradiesischen Ortes, „Shangri-La“. Dieser ist in der amerikanischen Populärkultur vor allem durch den Unterhaltungsroman Lost Horizon von James Hilton aus dem Jahr 1933 und Frank Capras Verfilmung LOST HORIZON (USA 1937) bekannt.48 Das untersuchte Flippermodell kommt 1967 auf den Markt; Oppitz perspektiviert es als weitere Mythenerzählung, die zusätzliche Elemente in den „Klischeespeicher Shangri-La“ (ebd.: S. 53) integriert, dem er sich ethnografisch-semiologisch nähert.49 In seiner detaillierten Analyse beschränkt sich Oppitz – wie auch schon Hainz – auf die Frontscheibe des Flippers, bezieht also das Spielfeld nicht mit ein.50 Handelt es sich bei Oppitz’ Studie um ein Spurenlesen auch von Capras Film herrührender Elemente, findet sich am Flipper selbst keine explizite Bezugnahme auf LOST HORIZON.
Dagegen werden vermehrt seit den 1980er Jahren Flippermodelle in ausdrücklicher Anlehnung an Filme und Filmreihen des Blockbusterkinos, auch an Fernsehserien (z. B. Charlie’s Angels, The Sopranos, The Simpsons), konzipiert und gestaltet. Mag im Marketing und Merchandising der Filmindustrie die Lizenzvergabe für Flippermodelle im Unterschied zu Games, Büchern, Comics usw. finanziell eine sehr untergeordnete Rolle spielen, scheint umgekehrt für die Überbleibsel der Flipperproduktion ein an populäre Filme orientiertes Art-Design erfolgversprechend, wo gegenwärtig neue Automaten von hauptsächlich noch einem Hersteller, der Chicagoer Manufaktur „Stern“, auf den Markt gebracht werden.
Solche filmthematischen Flipper sind die dritte und jüngste historische Verknüpfung von Flipper und Kino. Im Vergleich zur filmischen Motiv- und Zeichengeschichte ist das Verhältnis hier medientopisch umgedreht. Ökonomisch sind solche Flipper eine Zutat der Filmvermarktung, filmwissenschaftlich lassen sie sich als filmischer Paratext fassen. Außerdem ist der Flipper eine spezifische Adaption, eine Lektüre eines Films: Das Flippermodell kann daraufhin untersucht werden, auf welche Weise der Film auf Frontscheibe, aber auch auf Spielfeld und Spielregeln und -module übersetzt und angepasst wird. Dies soll im Folgenden am Flipper Indiana Jones: The Pinball Adventure unternommen werden.
Indiana Jones
1993 veröffentlicht der Flipperautomatenhersteller Williams Indiana Jones: The Pinball Adventure. Das von Mark Ritchie entworfene Modell bezieht sich auf die bis zu diesem Zeitpunkt erschienenen drei Filme der Indiana Jones-Filmreihe: RAIDERS OF THE LOST ARK (USA 1981), INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM (USA 1984) und INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE (USA 1989). Elemente von deren Diegese, Figuren und Objekte werden in die Gegebenheiten des Automaten übersetzt.51
Die größte Nähe zu den Filmen findet sich auf der Frontscheibe:
Für das Leuchtbild sind fotorealistisch Figuren aus den Filmen entnommen, am prominentesten der Oberkörper Harrison Fords als titelgebende Figur mit obligatorischem Hut und Peitsche über der Schulter; um sein Konterfei sind kreisförmig vier weitere Filmfiguren in kleineren Abbildungen zu sehen. Der Kopf von Jones ist im zentralen Rundbogen eines aus drei Bögen bestehenden Säulengangs platziert. Dass die Flipperfrontscheibe ein Triptychon zeigt, entspricht den drei Teilen der Filmreihe. Jeder Bereich des Bildensembles ist einem der Filme zugeordnet und komprimiert einzelne Filmszenen: Der linke Bildteil gehört dem dritten Teil der Reihe an, der rechte dem zweiten. Die in der Mitte der unteren Bildhälfte sichtbare Bundeslade ist zentrales Motiv des ersten Films; in den anderen Bilddritteln sind diejenigen Objekte abgebildet, die die Plots der beiden anderen Filme bestimmen: der Heilige Gral und ein hinduistischer Sivalinga-Stein. Wollte man – entgegen der abendländischen Tradition – die Frontscheibe von rechts nach links lesen, sind die Bildteile in chronologischer Folge angebracht, insofern der zweite Film diegetisch ein Prequel zum ersten ist. Die gesamte Frontscheibe bezieht also drei Elemente ein: Filmfiguren, Filmszenen und in der Filmhandlung relevante Objekte. Hinzu kommen Schriftelemente: Auf der oberen Bildhälfte prangt der Name „Indiana Jones“. Typographisch entspricht er dem Titeldesign, das ab dem zweiten Film verwendet wird: Von links nach rechts verkleinert sich die Schriftgröße der einzelnen Buchstaben, was den comichaft gestalteten Schriftzug dynamisiert. Die Farbgebung unterstützt das: Vertikal gehen die einzelnen Buchstaben von Rot über Orange zu Gelb über. Die Frontscheibe stellt für den Flipper eine Art Werbung dar, weil sie dasjenige Automatenteil ist, das für potentielle Spieler_innen schon aus der Distanz sichtbar ist und lockt. Aus der Perspektive des Kinos ist die Frontscheibe so Äquivalent zum Filmplakat – indes als konstitutiver Teil des Beworbenen selbst.
Wo das Filmplakat Motive versammelt, die dem Film entnommen sind, kehren auch die in der Flipperfrontscheibe gezeigten filmischen Elemente (Figuren, Narration, Objekte, Schrift) auf dem Spielfeld und im Spielverlauf wieder. So sind Bilder von Köpfen verschiedener Figuren und von Filmobjekten auf dem Feld verteilt, Targets sind mit Namen versehen. Noch prägnanter sind dreidimensionale Miniaturen, die an Objekte in den Filmen angelehnt sind: einige sind dekorativ (Flugzeuge), andere für das Spiel funktional (Goldschädel, Brücke).
Ein Objekt ist besonders markant: Der Abzug der Flipperkugel am Automaten ist als Revolver gestaltet. Die Farbgebung des Spielfeldes nimmt das Rot, Orange und Gelb des Indiana Jones-Schriftzugs auf, ergänzt vor allem durch Grün, das Urwälder als wiederkehrende filmische Schauplätze assoziieren lässt. Die über das Feld verteilten farbigen Lichtquellen, die unterschiedlich aktiviert werden, sorgen für eine atmosphärische Note. Noch expliziter als die visuellen verweisen akustische Elemente auf die Filme:52 Während des Spielverlaufs werden filmische Originaltöne eingespielt: wiederkehrende Dialogfetzen und Originalfilmmusik, ergänzt durch eigens produzierte Geräuscheffekte (Peitschenknall, Affengebrüll, Mopedgeknatter, Schlangengezisch, Elefantengetröte, Flugzeugmotorengebrumme, Pferdegeklapper u. a.). Die Stimme, die den Spieler_innen Anweisungen gibt, gehört dem Schauspieler John Rhys-Davies, der selbst in zwei der drei Filmteile mitspielt.
Die skizzierten Bezüge des Flippers auf die Filme folgen einer Praxis der Fragmentierung: Elemente werden aus den Filmen herausgelöst, um sie auf die Spielfläche zu verteilen. Der Flipperautomat verhält sich zum Film wie es die Montage zu Kader und Tonspur tut: Es wird herausgetrennt und neu zusammengefügt. Doch entsteht im Flipper hieraus kein chronologisch und topologisch geordneter Zusammenhang, stattdessen bleiben die Komponenten verstreut. Der Automat nivelliert damit den Stellenwert von Filmpersonnage, Szenen, Objekten, Schriften und Tönen, weil diese gleichberechtigt sicht- und hörbare Teile des Automaten sind.
Diese Praxis der Fragmentierung zeigt sich auch in den Spielmodulen von Indiana Jones: The Pinball Adventure. Der Spielablauf teilt sich in zwölf Module auf, die je nach Aktivierung zu unterschiedlichen Zeitpunkten spielbar sind und je bestimmte Targets, Lanes und Rampen integrieren, deren Anspielen mit der Kugel Punkte erbringt. Der Automat weist drei Spielmodule auf, die nicht auf dem eigentlichen Spielfeld, sondern ausschließlich über den auf der Frontscheibe integrierten Bildschirm zu bewältigen sind. Der Screen wird ansonsten dafür benutzt, Punktestände anzuzeigen, zu den verschiedenen Modulen zugehörige Elemente zu visualisieren oder schriftlich Spielanweisungen zu geben. Bei jenen drei Modulen, die auf dem Screen stattfinden, wird den Flipperknöpfen ihre eigentlich Funktion – das Auslösen der Flipperarme – genommen, sie lösen nun Bewegungen auf dem Screen aus. Der Flipper integriert damit Spielweisen, die mit dem Flippern nichts mehr zu schaffen haben, sondern der Video- und Computerspielkonsule entlehnt sind. Alle zwölf Spieleinheiten wiederum rekurrieren auf Handlungselemente, je vier auf einen Film. Die narrativen Komponenten des Flipperspiels orientieren sich an bestimmten Sequenzen der Filme, modifizieren sie aber für eine Spielaufgabe: Der Flipper überträgt also Sequenzen und narrative Elemente nicht in Form von Levels, die nacheinander gespielt werden müssen; die Spielmodule gehorchen nicht einer invarianten Folge. Somit entsagt der Flipper der Logik erzählerischer Kontinuität.
Eine solche Diskontinuität korrespondiert grundlegend dem Wesen der Flipperkugel. Sie schießt zwischen Objekten, Bildern und Schriftelementen des Spielfelds umher und löst Spielmodule (sowie dazugehörige Tonspuren und Visuals auf dem Bildschirm) und Punktgewinne aus. Gibt es bezüglich der Adaption von Filmen in die Logik eines Flippers selbstverständlich Überschneidungen mit Games, ist der wesentliche Unterschied, dass Flipperspieler_innen kein Avatar, keine sekundäre Identifikationsfigur offeriert wird. Stattdessen ist die Kugel als zentrales Objekt des Spiels: Bewegung. Zum einen ist damit eine immer gleichbleibende Bewegung gemeint, das Nach-Unten-Rollen, zum anderen eine nicht vorhersehbare Bewegung, das Umher-Prallen. Diese für alle Flipper grundlegenden Bewegungsformen der Kugel gewinnen im Zusammenhang der Filmadaption (wie derjenigen der Indiana Jones-Filme) eine weitere Relevanz. Da die Übertragung der Filme auf den Automaten den Prinzipien von Fragmentierung und Diskontinuität folgt, wird gerade nicht auf die Chronologie der diegetischen Handlung und die Identifikation mit Protagonist_innen abgehoben. Dagegen betont der Flipper Anderes der Indiana Jones-Filme: deren spektakuläre Ereignishaftigkeit und somatische Affektpraxis – also diejenigen filmischen Charakteristika, die unter Bewegung (im weiteren Sinne) subsumiert werden können. Mit deren Prävalenz in der Adaption ist der Flipper dem Blockbusterkino im Besonderen adäquat.
Noch vice versa lässt sich eine spezifische Nähe des Flippers zum Blockbusterkino in flipperesken Elementen im Film selbst entdecken. Der erste Teil der Indiana Jones-Reihe, RAIDERS OF THE LOST ARK, erweist dem Flipper prominent gleich zu Beginn Reminiszenz.
Den Dschungel Südamerikas durchforstet der Archäologe Jones nach einem Heiligtum einer untergangenen Hochkultur, das er schließlich in der Ruine eines peruanischen Tempels findet. Die goldene Götzenfigur bekommt er zwar in seine Hände, löst dadurch aber unwillentlich uralte Vorrichtungen aus, die zur Abwehr von Eindringlingen und Räubern installiert wurden. Den Parcours tödlicher Gefahren überwindet Jones in größter Not, an dessen Ende erwartet ihn jedoch noch eine riesige, steinerne Kugel, die aus ihrer Halterung katapultiert wird und in großer Geschwindigkeit den abschüssigen Gang hinter Jones hinabrollt.53 Im allerletzten Moment kann er, die Götze in seinen Händen, der massiven Kugel entkommen, die den Zugang zum Tempel mit Wucht verschließt.
Anders als in der filmischen Motiv- und Zeichengeschichte zeigen die Indiana Jones-Filme keine aufgereihten Automaten, keine Spielhallen, keine herumlungernden Flipperspieler_innen. Mit der überdimensionierten, eine Kuhle hinab rasende Kugel als dramaturgischem Höhe- und Schlusspunkt der Anfangssequenz von RAIDERS OF THE LOST ARK referiert die Filmreihe auf den Flipper nicht als manifestes Objekt, sie indiziert ihn als Spur (obwohl er völlig aus dem modernen urbanen Milieu hinaus in den Dschungel und die Frühhistorie verrückt wird – des Tempels, aber auch der Frühgeschichte des Flippers selbst, der zum filmdiegetischen Zeitpunkt der 1930er Jahre in seiner geläufigen Bauart so noch nicht konstruiert ist). Die Indiana Jones-Reihe bedient sich ikonografisch und narrativ beim Dschungel- und Abenteuerfilmgenre der 1930er und 40er Jahre, bei exotistischen literarischen Räuberpistolen, Groschenheftchen, Pulpfiction, Comics, Vaudevilles, Freakshows und Jahrmarktattraktionen. Die Filme werden so zum Ausstellungsraum eines massenkulturellen Sammelsuriums des 19. und 20. Jahrhunderts. Die rollende Kugel wiederum ist Zeichen der da noch jüngsten massenkulturellen Archivierung, der Flipperkultur. Diese latente Art der Referenz auf die Unterhaltungskultur des Flippers macht die Indiana Jones-Reihe just zu demjenigen Zeitpunkt – Anfang der 1980er Jahre – als sich deren Hochzeit dem Ende zuneigt, in den Spielhallen schon elektronische Bildschirmspiele Einzug gehalten haben und Videospielkonsolen für Privathaushalte auf den Markt gekommen sind.
An diesem Übergang in der Geschichte massenkultureller Automatenspiele partizipiert auch die Indiana Jones-Filmreihe. Sie tut dies zum einen im Merchandising, wenn mehrere Computerspiele zu den Filmen herausgebracht werden, zum anderen in den Filmen selbst. Der zu Beginn vor der riesigen Kugel flüchtende Indiana Jones fungiert fortan selbst als Äquivalent einer umherprallenden Flipperkugel: Die dynamische, von Springen, Hüpfen, Hangeln, Schwingen, Fallen, Rollen geprägte Eingangssequenz von RAIDERS OF THE LOST ARK ist stilprägend für den Ereignischarakter aller Filme, in denen der Wissenschaftler Jones selten in Hörsälen Vorlesungen abhält, sondern Urwälder, Zeppeline, Höhlen, Katakomben, Hängebrücken, Schlangengruben mit Skills meistert. Der somatische Ereignis- und Affektcharakter der Filme assoziiert einerseits die da neueren Unterhaltungsmedien der elektronischen und alsbald digitalen Games mit ihren Levels und Aufgaben, andererseits die alten Kirmes- und Freizeitparkkulturen, deren Attraktionen Karussell, Geisterbahn, Wasserrutsche und andere Katapulte im Blockbusterkino neu reüssieren.54 Die Kugel zu Beginn der Filme weist den Flipper als Scharnier zwischen jenen neueren und älteren Kulturen aus. Programmatisch wird in den Filmen der Indiana Jones-Reihe jene ‚Rechnung’ neu aufgemacht, die in LES QUATRE CENTS COUPS (wie eingangs beschrieben) der Dreisatz von Kino, Flipper und Jahrmarktvehikel bildet. Im Blockbusterkino ist nun aber ihre Summe berechnet.
Der Umstand, dass der Flipper nicht als Filmmotiv erscheint, korrespondiert der seit den 1980ern zunehmenden Herstellung filmthematischer Flippermodelle. Nur an deren Schauplatz wird die Verbindung zum Kino manifest, während umgekehrt der Flipper das Blockbusterkino nurmehr als Spur durchzieht.
Rumpelkammer der Geschichte
Friedrich Heubach verkündet Anfang der Siebziger: „Es gibt zur Zeit keinen besseren Flaubert als den Flipper“; er provoziert nicht nur mit dem ähnlichen Wortklang und der Gleichsetzung von Hoch- und Unterhaltungskultur, sondern versteht den massenkulturellen Spielautomaten in der Nachfolge des bürgerlichen Romans des 19. Jahrhunderts, was dessen Aussagekraft für den Status moderner Subjektkonstitution betrifft. Diese behauptete Bedeutung des Flippers scheint mit seiner meist damals schon räumlichen Prekarität zu kollidieren: „In den Städten zumeist per Order in die Gegenden zwischen Bahnhof und Strich angesiedelt, sind die Spielhallen bereits als Räume der Instabilität gekennzeichnet.“ (Hainz 1970: S. 23) Diese Orte der billigen Unterhaltung – in der Nähe auch der Bahnhofskinos jener Zeit – künden seinen (hochnäsig bourgeois gewünschten) Niedergang als Unterhaltungsmedium an, wenn schon damals hellseherisch prognostiziert wird, der Flipper „steht [...] in den Städten und wartet auf seinen Abgang in die Rumpelkammer der Geschichte.“ (Ebd.: S. 23) In den 1990ern muss Paolo Virno deswegen ganz grundsätzlich konstatieren: „On se plaint : les bars n’en sont pas, les usines ne ressemblent plus à des usines, les adolescents sont prudents et sceptiques. Le flipper a disparu du paysage urbain et le Parti communiste aussi : que faire ?“ (Virno 1998: S. 86) – fragt Virno schließlich mit Lenin, um nicht völlig nostalgisch-resignativ zu klingen.
Der ökonomische, kulturelle und soziale Bedeutungsverlust, der den Flipper seit den 1980ern rapide ereilt hat, zeigt einen Wandel massenkultureller Unterhaltung an. Die Spielhallen selbst (und die bürgerlichen Kasinos sowieso) sind davon nicht betroffen, ebensowenig wie ihre Spielautomaten mit Geldgewinnmöglichkeit. Auch diejenigen Spiele, die den Wettkampf oder das Gruppenerlebnis feiern, wie Billard und Kickerkasten, sind in Kneipen weiter vertreten. Das relative Verschwinden des Flippers aus dem öffentlichen Raum verläuft aber parallel mit dem Einzug elektronischer, televisueller und digitaler Spielkonsolen in Privaträume. Die Gemengelage, dass der Flipper kein Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit ist, dass er nicht Kollektivierung (oder deren Surrogat) befördert und dass er zudem technisch für Störungen anfällig und seine Wartung umständlich und kostspielig ist, mag ausschlaggebend für seine Marginalisierung sein.
Jener Strukturwandel betrifft also die Freizeitkultur im Fordismus. Analysiert man den Flipper als Analogon fordistischer Fabrikarbeit (oder stellt beide in einen Funktionszusammenhang), wie es die marxistische Linke der 1970er Jahre tut, dann würde der Bedeutungsverlust gerade des Flippers (und nicht der anderer Spielautomaten) Transformationsprozessen kapitalistischer Arbeitsverhältnisse korrespondieren. Von der sukzessiven Marginalisierung industrieller Produktion in den westlichen kapitalistischen Staaten seit den 70ern lässt sich – will man der kulturindustriethetischen Analyse folgen – ableiten, dass dies auch zu Modifikationen der Subjektivierungsformen und biopolitischen Maßnahmen in der Freizeitkultur und ihren Spielen führen muss.
An jene Aspekte – fordistische Freizeitkultur der Nachkriegsjahrzehnte und deren Strukturwandel unter den Vorzeichen postfordistischer Ökonomie – schließt die Frage an, auf welche Weise das Kino die Geschichte des Flippers spezifisch flankiert. Als Ausstattungsobjekt, Motiv und Zeichen v. a. in den 1950er, 60er und 70er Jahren verschafft die Filmgeschichte dem Flipper ein audiovisuelles Archiv: Der Automat ist nicht Konservat, es wird (meistens) an ihm gespielt, qua filmischem Medium ist er Teil von sozialen Räumen und Architekturen. Was am Automaten ausgehandelt wird, nimmt Themen, die in populären und wissenschaftlichen Publikationen zum Flipper behandelt werden, größtenteils vorweg; Aspekte werden verdichtet und zugespitzt, was etwa die Verhandlungen von Sprache, Jugend, Urbanität, Delinquenz oder Geschlechterverhältnissen (die in der Literatur kaum vorkommen) angeht. Die nationalkinematografischen Besonderheiten korrespondieren zudem den unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen für Spielautomaten.
In diesem ersten Verhältnis dokumentiert und signifiziert der Film die Flipperkultur; das zweite, strukturelle Verhältnis von Kino und Flipper behandelt dann in dialektisch-materialistischer Analyse Ähnlichkeiten beider Freizeitkulturen. Beim Text von Bernd Jürgen Warneken handelt es sich nicht im engeren Sinne um einen rezeptionstheoretischen Vergleich, der dann vielleicht auch die Differenz von geruhsamem Sitzen im Kinosessel und lässigem oder angespanntem Stehen am Flippertisch benennen müsste. Stattdessen wird der Flipper in die Tradition von Chock und Zerstreuung gestellt. Wenn Walter Benjamin und Siegfried Kracauer in den 1920er und 30er Jahren dem Kino eine bedeutsame subjektkonstitutive und auch gesellschaftsanalytische Rolle zuweisen, avanciert bei Warneken der Flipperautomat in den 1970ern zu einem vergleichbaren Objekt. Zeithistorisch geschieht dies, wenn das Kino selbst in eine Krise geraten ist, deren einer Grund in der Konkurrenz zum Fernsehen liegt. Vice versa ist es bemerkenswert, dass in der linken Theorie der Flipper als passables Objekt von Gesellschaftskritik gerade dann entdeckt wird, wenn das Produktions- und Arbeitsregime des Taylorismus, das ihm entsprechen soll, weitreichenden Strukturveränderungen unterzogen ist.
Im Unterschied zum Flipper transformiert sich jedoch das Kino, dessen Tod schon bald ausgerufen wird, im Übergang zu postfordistischen Freizeitkulturen. Der Kinoraum selbst erfährt seine institutionelle und architektonische Neuformierung in Kinoketten und Multiplexkinos. Wichtiger in der sich seit den 1970ern forciert verändernden Freizeitkultur ist, dass der Film technisch und medial ausdifferenziert und relokalisiert wird – in einer Entwicklung, die der Implementierung von Spielekonsolen in Privaträume vergleichbar ist. (Hervorzuheben wäre die Digitalisierung des Kinos, die zwar auch am Flipperautomat stattfindet, der aber dort eine materielle Grenze gesetzt ist.)
Der gesellschaftliche Bedeutungsverlust des Flippers zeigt sich aus filmgeschichtlicher Perspektive nicht nur im relativen Verschwinden als Ausstattungsobjekt. Vielmehr reflektiert der Film (bzw. das Musikvideo) nicht zuletzt neue Subjektivierungsformen durch die ökonomischen Transformationsprozesse, wenn der Flipper in Form überdimensionierter Spielflächen oder Kugeln repräsentiert ist. Wo der großstädtische Raum bei Godard oder Debord in der Assoziation mit dem Flipper bildpolitisch analysiert wird, verheißen die grotesken Gigantismen in TOMMY Mitte der 70er zum Esoterischen tendierende Selbsterfahrung im Flipperspiel. Dort wird am Filmende dem Heilsversprechen maschinenstürmerisch mit der Zerstörung der Automaten geantwortet – eine sentimental antimoderne Geste, wo doch schon die riesigen Flipperkugeln die Landschaft dominieren. Folgerichtig ist nur, dass im Musikvideo zu No Limits! Anfang der Neunziger (wie ebenfalls schon angerissen) die Subjekte nicht mehr flippern, sondern auf dem Spielfeld ausflippen. Das Hantieren am Spielautomaten, das marxistisch als Konditionierung und Aggressionsabfuhr gelesen wurde, ist ganz nutzlos geworden. Das Flippern ist dysfunktional geworden für die subjektkonstituierenden Zwecke des Postfordismus. Dies sagt das Bild der zu einer Art Flipper gewordenen Umwelt aus: Der Flipper ist nicht mehr Objekt, nun vielmehr ästhetische und soziale Struktur immersiver Affektarbeit. Kein Platz hat hier mehr die alte bildungsbürgerlich-reaktionäre Kritik gegenüber dem Süchtigmachenden des Spiels, weil die Programmatik postfordistischer Affektarbeit gerade auf solcher lustvoller Verausgabung fußt. Dies schließt auch die Indiana Jones-Filme ein, in denen das Wegrennen vor der ‚Flipperkugel’ und überhaupt die Körperlichkeit im Feld – dem archäologischen Feld wie dem Spiel-Feld des flipperesken Blockbusterkinos – die Tristheit und Trägheit im bürgerlichen Alltag des Wissenschaftlers nicht nur grell kontrapunktieren wollen; überhaupt wird damit spektakulär-affektive Arbeit gefeiert.
Kein Objekt mehr in solchen Arten der filmischen Repräsentation sekundiert dies der Ortlosigkeit des Flippers in der zeitgenössischen städtischen Freizeitkultur. Ökonomisch wie ästhetisch antwortet die neuere Flipperproduktion darauf, indem sie mit filmthematischen Automaten um die Obhut des Kinos bittet. Umgekehrt wird – mit der Adaption von Tönen, Bildern und Narrationen – dem Film ein ganz handfester Schauplatz gestattet, nämlich in einem schweren und teuren Automaten, was in Anbetracht der heutigen medial-topischen Verstreuung des Mediums Film anachronistisch anmutet.
Genau so nostalgisch mag es sein, den Körper in einer verrauchten Eckkneipe oder einem Hobbykeller – schlechthin Rumpelkammern einer fordistisch-massenkulturellen Geschichte – am Flipper – jetzt – überrumpeln zu lassen.
- 1Heubach 1972b: S. 244. Erste, knappe Überlegungen zum Verhältnis von Flipper und Kino finden sich in: Göttel 2014: S. 52-55.
- 2Heubachs Forschung zum Flipper hat mehrere Veröffentlichungen erfahren, die textlich mitunter nur leicht variieren; vgl. Heubach 1972a; vgl. Heubach 1982; vgl. Heubach 1072b.
- 3Speziell dem Zusammenhang zwischen Automatenspiel und frühkindlicher psychischer Entwicklung widmet sich die Studie in ihren theoretischen Passagen: „Wir sehen [...] einen spielerischen Umgang mit dem technischen Gerät, das in seinem Ernst und seiner Bedeutung für die Gesellschaft und ihre Zukunft so wichtig ist, wie die Mutter es für das Kind war. Denn beide, Mutter und Technik, garantieren für die Zukunft Wohlstand, Sicherheit, Sattheit, Lust. Im Spiel aber wird die Unabhängigkeit von all diesem erlebt.“ (Ebd.: S. 23) Und weiter: „Ob Spieler oder Nichtspieler, der Spielautomat wird als etwas Ähnliches erfahren wie eine in der frühen Kindheit erlebte Mutter, die in der Spielhalle wie in einem gemütlichen Heim haust. Vorurteile und Opposition gegen Spieler, Spielautomaten und Spielhallen weisen zurück auf eine frühe Kindheit, in der die zärtlich gewährende Mutter allzu früh abgelöst wurde durch Strenge und Forderungen nach Einordnung in Gesetzlichkeiten: es entsteht eine Triebhemmung. Triebbedürfnisse, die sehr früh gebremst wurden, führen später zu einer Vorurteilshaltung, vor allem gegenüber dem Spiel.“ (Ebd.: S. 55 f.).Rudolf Heinz’ metapsychologisches „Flipper-Fragment“ beschreibt eine generelle Strukturgleichheit zwischen Automat und Psyche aus: „Mitnichten illustriert der Spielautomat arbiträr per analogiam irgend didaktisch die Funktion des psychischen Apparats. Wenn schon, so figuriert dieses mortale Sonderding als Organprojektion des vitalen Innenmechanismus der Seel (und umgekehrt dieser als Introjektion jenes).“ (Heinz 1989: S. 675.
- 4Schimank konstruiert eine pädagogisch vermittelte Analogie von Flippern und Lebenskunst, d.h. hier: moderner Selbstoptimierung: „Wie kann der einzelne es vermeiden, durch immer wieder auftretende Identitätsgefährdungen in chronische existenzielle Verunsicherung und Verzweiflung gestürzt zu werden? Zur Beantwortung dieser Frage will ich einen zunächst sicherlich gewagt, ja sogar frivol anmutenden Vergleich anstellen. Ich will die um die Identitätsbehauptung bemühte Person mit einem Flipperspieler vergleichen und zeigen, daß die Art und Weise, wie dieser trotz aller Widrigkeiten etwas erreichen, nämlich Punkte sammeln und Freispiele erzielen kann, den in der modernen Gesellschaft angemessenen Praktiken der Identitätsbehauptung gleicht. Wer über Flipperspielen nachdenkt, kann also Lebenskunst lernen.“ (Ebd.: S. 250 f.).
- 5Das vollendete Meistern des Flipperns findet seine Entsprechungen in buddhistischen Termini: „Mit der Möglichkeit, Freikugeln und Freispiele gewinnen zu können, kommt unter anderem auch die Idee der Wiedergeburt ins Spiel. Die Kugel mag zwar sterben, doch wenn der Spieler eine bestimmte Fertigkeit erreicht hat (sein Verhalten also bestimmten qualitativen Normen genügt), kann er sie zu neuem Leben erwecken und gewinnt so die Möglichkeit zu einer neuerlichen Wiedergeburt der Kugel. So entsteht ein endloser Kreis von Leben, Tod, Wiedergeburt, der dem zen-buddhistischen Konzept des Samsara ähnlich ist. [...] Dieses Ziel besteht aus dem ununterbrochenen, ewigen Spiel einer einzigen Kugel; es ist Nirwana.“ (Ebd.: S. 123).
- 6Die massenkulturelle Bedeutung des Flippers speziell in den USA, wird in einem Zitat aus einem Text Bernard Asbells, einer Reportage über den Flipperhersteller „Gottlieb“ deutlich, gerade im Vergleich mit einem hochkulturellen Beispiel: „In pianos the name is Steinway and in pinball games the name is Gottlieb, the aristocrat of instruments, preferred by all discriminating players. The Gottlieb – to be sure – is a democratic kind of aristocrat; you can find one almost anywhere. An inscription on every Gottlieb rings of wholesome sportsmanship: ‚Amusement Pinballs – as American as Baseball and Hot Dogs’.“ (Asbell 1963: S. 20).
- 7„Pinball-ology“ lautet der Titel eines Kapitels in Marco Rossignolis umfassendem, populärwissenschaftlichem Buch zum Flipper; vgl. Rossignoli 2000: S. 20.
- 8Vgl. z. B. Murakami 1980, vgl. Horstmann 1990, vgl. Eco 1988. Eine experimentelle literarische Form, die das Flippern zum Motiv hat, wählt Claude Vandeloise, der historische Persönlichkeiten und spezifische Flippermodelle zusammenführt; die jeweiligen Flipperpartien werden in Kurzgeschichten imaginiert, die außerdem von Zeichnungen der Flippermodelle begleitet werden; vgl. Vandeloise 1977.
- 9Vgl. Adamov 1955, Fo 1960.
- 10Vgl. z. B.: Joseph Cornell, Untitled (Penny Arcade Portrait of Lauren Bacall) (ca. 1945/46); William T. Wiley, Punball: Only One Earth (2007-2008).
- 11Vgl. z. B.: Wayne Thiebaud, Four Pinball Machines (1962); Robert Indiana: The Red Diamond American Dream #3 (1962); Blinky Palermo, Flipper (1970); Maria E. Piñeres, Hic et Nuc (Here and Now) (2012) (vgl. auch andere Arbeiten von Piñeres); Charles Bell, 100 Points When Lit (1981) (vgl. auch andere Arbeiten von Bell). In der Ausstellung „Pinball in Contemporary Art“, die 2011 im Pacific Pinball Museum stattfand, wurden einige der hier angeführten künstlerischen Arbeiten präsentiert; vgl. www.pacificpinball.org.
- 12Vgl. z. B.: Candida Höfer, Flipper (1973).
- 13Vgl. z. B. Dieter Schnebel, Flipper (Kammermusik für Spielautomaten, Darsteller, Instrumente, Tonband) (2002/2003); bei den Fehlfarben singt man wiederum: „ich schau mich um und seh nur ruinen. vielleicht liegt es daran daß mir irgendetwas fehlt. ich warte darauf daß du auf mich zukommst. vielleicht merk ich dann daß es auch anders geht. dann stehst du neben mir und wir flippern zusammen. paul ist tot kein freispiel drin. ein fernseher läuft taub und stumm. ich warte auf die frage die frage wohin.“ (aus: Fehlfarben, „Paul ist tot“ (Monarchie und Alltag) (1980).
- 14Vgl. z. B.: Moschino Pinball Bomber Jacket.
- 15Vgl. z. B.: Peellaert 1967.
- 16Virno 1998: S. 82. In seinem Text adaptiert Virno Pier Paolo Pasolinis „Von den Glühwürmchen“, wo die Zäsur des italienischen Nachkriegskapitalismus am Verschwinden der Glühwürmchen festgemacht wird. Virno indes distanziert sich von Pasolinis vermeintlichem Nostalgismus, weil ihm Trauer über das Verschwinden des Flippers nicht als politische Haltung geeignet scheint; vgl. Pasolini 1975.
- 17Vgl. http://www.pingeek.com/film/film.htm.
- 18Eine der IMDb nicht unähnliche Datenbank von Flippermodellen ist die Internet Pinball Machine Database; vgl. www.ipdb.org.
- 19Parinaud 1959: S. 1. Im Interview heißt es weiter: „Ce n’est pas un paradoxe car, en dehors de ce jeu, je constate surtout qu’il existe essentiellement des différences entre nous.“ (Ebd.: S. 1).
- 20François Truffaut im Interview, in: Le Monde, 24. Januar 1962.
- 21In der Auswertung des Fragebogens der empirischen Studie der Deutschen Gesellschaft für Sozialanalytische Forschung Anfang der 1970er Jahre nennen 61 Prozent der jüngeren Spieler_innen (bis 24 Jahre) den Flipper als liebsten Automatentyp; vgl. Meistermann-Seeger/Bingemer 1971: S. 39.
- 22Uwe Schimank hingegen will im Flipperspielen einen pädagogischen Wert erkennen, der im Kontext „biographische[r] Selbststeuerung“, also von Selbstoptimierung, nutzbar gemacht werden, weswegen der Flipper am besten Eingang in den Staatsapparat Schule finden sollte: „Wer es schafft, so zu flippern, daß er sich immer wieder herausgefordert fühlt, sein Bestes zu geben, wer sich bemüht, die Kugel im Spiel zu halten, um glückliche Koinzidenzen zu initiieren, wer gelegentliche Chancen gezielter Treffer zu nutzen lernt und so allmähliche Erfolgserlebnisse hat, und wer sich nicht von der Hektik des Geschehens anstecken läßt, sondern ruhig bleibt: Der erwirbt eine Haltung, wie er sie bei seiner biographischen Selbststeuerung benötigt. Vielleicht sollte man Flipperspielen in die schulischen Lehrpläne einbauen. Es gab schon unsinnigere pädagogische Konzepte.“ (Schimank 1999: S. 270) Als kritische Entgegnung auf diese Position lässt sich z. B. Michael Oppitz’ Verständnis der spielerischen Didaktik des Flippers im Sinne einer Stabilisierung bestehender kapitalistischer Ordnung lesen: „Das Konkurrenzprinzip, das am Arbeitsplatz die Arbeitenden nur rädert und verschleißt, findet hier seine paradiesische Apotheose. Es wird zur Quelle von Erholung, zum Lebenselixier. Schließlich ist der Flipper ein didaktisches Gerät. Er übt den Spieler ein auf das, was in der hiesigen Gesellschaft am meisten zählt: die Leistung. Doch wie bei allen guten Lehrmitteln vollzieht sich diese Leistung spielerisch.“ (Oppitz 1974b: S. 95).
- 23Zu Anrufung bzw. Interpellation als Begriffe im Kontext von Ideologiekritik vgl. Althusser 1970.
- 24Barthes 1970: S. 44f.
- 25Zum Pachinko vgl. auch Caillois 1967: S. 1125.
- 26Heubach 1982: S. 128.
- 27Der Flipper stellt darüber hinaus für Lettrismus bzw. Situationismus ein Denk-Objekt innerhalb des Konzepts des „Dérive“ dar. So erwähnen Guy Debord und Gil Wolman ein nicht umgesetztes und nicht näher spezifiziertes Projekt mit dem Titel „Des sensations thermiques et des désirs des gens qui passent devant les grilles du musée de Cluny, une heure environ après le coucher du soleil en novembre“, das den Stadtraum als eine Art Flipperautomat und die Bewegungen von Menschen darin als mehr oder weniger vorhersehbare, denjenigen einer Flipperkugel nicht unähnliche begreift; vgl. Debord/Wolman 1956; vgl. hierzu auch: Sadler 1999: S. 90. Außerdem wird der Galton-Apparat – Vorläufer des Flipperautomaten – gleich in zwei Ausgaben der Zeitschrift Internationale situationniste abgedruckt: „One of the metaphors of the dérive—reprinted twice in the SI’s journal, Internationale situationniste 1 (1958) and Internationale situationniste 7 (1962)— is the Galton apparatus, or pinball machine, a device developed by Francis Galton in the early 1870s for the demonstration of the formation of Gaussian distribution or the bell curve. However, for the SI, its significance was not the figure of the final distribution of the balls but the field of passage within the grid of the apparatus. [...] What is important is the time-space between positions, the in-between, no longer simply a ground to be traversed from one position to another but a field, a ‚force-field’ activated by bodies in dérive, the turntable less as destination than as inducer of movement, of attraction or repulsion.“ (Yoon 1959: S. 53).
- 28Eine komödiantische Variation des Topos von Flipper und Sex bietet Bad Santa (USA 2003) auf: Der männliche Protagonist leistet einer jungen Frau Schützenhilfe, wenn er hinter ihr stehend seine Hüften bewegt, um ihr die passende Körperhaltung beim Flippern zu demonstrieren.
- 29Die Verbindung sexueller Gewalt und Flipper wird auch in einer Skulptur von Edward Kienholz und Nancy Reddin Kienholz verhandelt, die den Titel The Bronze Pinball Machine with Woman Affixed Also (1980) trägt und das Playboy-Flippermodell so präpariert, dass es wie ein Bett anmutet; außerdem sind zwei bronzene Frauenbeine an das untere Ende des Flippertischs montiert, die das Ensemble zu einem Hybrid von Flipper und Frauenkörper machen.
- 30Das Motiv des Flippers im bundesrepublikanischen Neuen Deutschen Film kommt auch – und titelgebend – in Klaus Lemkes Kurzfilm STRATEGEN (alternativer Titel: FLIPPER) (BRD 1966) vor.
- 31„Es geht also im Film [...] in erster Linie nicht um irgendwelche größeren politischen Strukturen, sondern es geht darum zu zeigen, wie Gewaltanwendung durch private Dinge, durch Liebe und Gefühle, wie das zusammenhängt, oder daß da Zusammenhänge sind. Daß man versuchen sollte, im ganz Privaten Revolution zu machen, nicht irgendwelche Umschwünge zu machen zu einem Zeitpunkt, der gar nicht richtig ist. Das ist meine Vorstellung von Sozialismus.“ (Färber/Jenny/Roth 1969: S. 475).
- 32Der Exkurs zu Sozialismus, Ehe und Flipper schließt mit Urs Jennys Bekenntnis: „In Frankfurt hätte ich neulich beinahe einen Flipper gekauft...“ (Ebd.: S. 475).
- 33Fradys zum Literarischen tendierender Text ist ein autobiografisches, nostalgisches Portrait amerikanischer Jugend in den 1950ern im Zeichen des Flippers; im Playboy ist er ausladend illustriert.
- 34In der 21. Episode der 3. Staffel (2012) der TV-Serie GLEE gibt es in der Schulaula ein Reenactment des Songs des Pinball Wizard als queere Aneignung: Ein Schüler tritt als Transe auf, begleitet von einer Performance, bei der Tänzer_innen mit Flipperautomaten auf Rollen die Bühne bespielen. Vgl. http://perezhilton.com/tv/GLEE_Alex_Newell_Performs_Pinball_Wizard/?id=b...
- 35Claes Oldenburg, Giant Pool Balls, 1977; Aaseeterrassen, Münster; ein anderer Film, der ebenfalls zu grotesk riesenhaften Flipper-Arrangements neigt, ist THE FINAL PROGRAMME, R: Robert Fuest, GB 1973.
- 36Ein anderes Beispiel von Linklater ist BEFORE SUNRISE (USA 1995), wo die beiden Verknallten minutenlang in einer Wiener Kneipe flippern und dabei über ihre romantischen Beziehungen plaudern;vgl. http://www.youtube.com/watch?v=GinBWW1p1GE
- 37Für eine sozialempirische Perspektive zum Geschlechterverhältnis in der Flipperszene vgl. Manning/Campbell 1973: S. 344-348.
- 38Dass die Jukebox möglicherweise ein ähnliches Schicksal erlitten hat wie der Flipper, davon zeugt eine literarisch-essayistische Darstellung Peter Handkes: „[K]aum einer von seinen Bekannten, die er in den letzten Monaten – als eine Art Marktforschungsspiel – danach gefragt hatte, [hatte] mit dem Gerät etwas anzufangen gewußt. Die einen, unter ihnen freilich auch ein Priester, hatten nur die Achseln gezuckt und den Kopf darüber geschüttelt, daß derartiges überhaupt von Interesse sein konnte, die anderen hielten die Jukebox für einen Flipper, wieder andere kannten nicht einmal das Wort und glaubten erst bei ‚Musicbox’ oder ‚Musiktruhe’ zu verstehen, was gemeint war.“ (Handke 1990: S. 11 f.
- 39Virno 1998: S. 86
- 40In einem ganz anderen theoretischen, nämlich neurologischen Bezug verwendet Gilles Deleuze en passant den Flipperautomat: „C’est vrai que la neurologie m’a toujours fascine. Mais pourquoi ? C’est qu’est ce qui se passe dans la tète de quelqu’un quand il a une idée. Je préfère quand il a une idée, parce que quand il n’a pas d’idée ca se passe un peu comme dans un billard électrique.“ ( L’ABÉCÉDAIRE DE GILLES DELEUZE [TV-Interviews mit Claire Parnet], F 1988/89, 1996).
- 41Heubach macht mit einigem Furor in der orthodox marxistischen Linken hingegen den Gegner einer linksemanzipatorischen Analyse des Flippers aus: „Ich kenne – von den Jugendschützern und den in abendländischen Werten Handelnden lohnt nicht die Rede – keine impertinenteren Beschränktheiten als die jener Moralmarxisten und verweinten linken Pestalozzis, die im Delirium ihres präservativen Humanismus’ wieder mal zeigefingernd ihr Menetekelchen absingen und sich nicht entblöden, aus der Diaspora ihrer säuberlichen Seelen den Flipper als/zur Ausgeburt spätkapitalistischer Surrogat-Produktion zu erklären. – Wem ist denn das etwas Neues, wer hat denn den Kapitalismus so metaphysisch böse gesehen, daß ihn der Witz verwundern kann, mit dem dieser auch noch das Löcken gegen die ihm konstitutiven Verdrängungen systemerhaltend zu integrieren versteht. Diese zwischen biblischer Strenge und linker Askese oszillierende Kulturkritik mißversteht öfter als erträglich den Marxismus als Schlabberlatz, der ihrem debilen Sabber die Nachsicht garantiere.“ (Ebd.: S. 131).
- 42In diesem Zusammenhang spricht Hainz von den Spielautomaten als „Prüfstände[n] der Realitätstüchtigkeit.“ (Ebd.: S. 23).
- 43In „Über einige Motive bei Baudelaire“ führt Benjamin auch das Hasardspiel – ein populäres Würfelspiel v.a. im 19. Jahrhundert – als Beispiel einer Freizeitbeschäftigung an, das er in Entsprechung zur kapitalistischen Fabrikarbeit verortet, insofern dort „die Vergeblichkeit, die Leere, das Nicht-vollenden-dürfen“ der Tätigkeit des Fabrikarbeiters gespiegelt sei. „Auch dessen vom automatischen Arbeitsgang ausgelöste Gebärde erscheint im Spiel, das nicht ohne den geschwinden Handgriff zustande kommt, welcher den Einsatz macht oder die Karte aufnimmt. Was der Ruck in der Bewegung der Maschinerie, ist im Hasardspiel der sogenannte Coup. Der Handgriff des Arbeiters an der Maschine ist gerade dadurch mit dem vorhergehenden ohne Zusammenhang, daß er dessen strikte Wiederholung darstellt.“ (Benjamin 1939: S. 223)
- 44Zur Kritik Warnekens an Kracauer vgl. Warneken 1974: S. 122f.
- 45Der Zeitschriftenaufsatz „Päng. Crack. Klumm. Zoff. Flopp. Blip. Kläng. Zachapp“ ist im Zeit-Magazin mit dem Autorennamen Dieter Hainz angegeben; im Literaturverzeichnis von Meistermann-Seegers und Bingemers Psychologie des Automatenspiels dagegen wird für den selben Aufsatz Benjamin Buchloh als Autor ausgewiesen, der außerdem als Mitarbeiter für jene Studie im Impressum genannt ist. Von Stil und Methode des Aufsatzes her lässt sich tatsächlich auf Buchloh als Autor schließen. Das Pseudonym Dieter Hainz wäre wahrscheinlich ableitbar von Buchlohs zweitem Vornamen, nämlich Benjamin Heinz-Dieter Buchloh.
- 46Hainz 1970: S. 23
- 47Eine ideologiekritische Analyse amerikanischer Flipperfrontscheiben der 1950er leistet auch Gianni Emilio Simonetti in einem Katalog zu einer Ausstellung solcher Scheiben in Mailand Anfang der 1970er; vgl. Simonetti 1970.
- 48Zu Capras Verfilmung kalauert Oppitz: „[W]eniger Shangri-La als Shangri-L.A.“ (Oppitz 1974b: S. 24).
- 49Oppitz analysiert sehr detailliert die spezifische Aneignungs- und Fortschreibungspraxis des Shangri-La-Mythos durch den Flipper: „[D]er Flipper Shangri-La [wirft] fiktive und reale ethnographische Fakten zusammen. Häufiger noch als vorfindbare und erfundene Ethnographica zu verbinden, ist beim Flipper Shangri-La ein anderes Verfahren zu beobachten: ethnographisch exakte oder partiell exakte Details werden aus dem kulturspezifischen Zusammenhang, in den sie hineingehörten, herausgenommen und als Ingredienzien einer willkürlichen, synkretistischen Auslese weiterverwertet. Da dieses Verfahren konstituierend ist für den ganzen Flipper als einem Zeichen, ist es angeraten, näher zu verfolgen, wie die als manipulierbare Fertigteile benutzten Details im einzelnen aussehen und als Bestandteile des ganzen Bildes montiert wurden.“ (Ebd.: S. 65).
- 50Hingegen ist der am Flipperautomat forschende Semiologe Oppitz selbst bildlich, nämlich in einer Fotografie, die mit dem Text abgedruckt ist, repräsentiert; das Foto stammt von Candida Höfer und gehört zu ihrer Serie Flipper (vgl. Anm. 12).
- 51Im Jahr 2008 erscheint ein weiteres von Stern produziertes Flippermodell, das auch den vierten Teil der Indiana Jones-Reihe – INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL (USA 2008) – bildlich und narrativ aufnimmt; dieser Flipper mit dem Namen Indiana Jones ist nicht Teil meiner Lektüre; für eine Rezension dieses Modells vgl. z. B.: http://www.pinballnews.com/games/indianajones/
- 52Indiana Jones: The Pinball Adventure ist das erste Flippermodell, das das Midway’s DCS Sound System verwendet; vgl. http://www.ipdb.org/machine.cgi?id=1267
- 53Beim Flipper wird jene Filmszene der rollenden, riesigen Kugel ins Videodisplay aufgenommen, sie begleitet dort die Funktion des Multiballs.
- 54Die kurze Passage, in der Benjamin in „Über einige Motive bei Baudelaire“ im Kontext des Choks den Lunapark mit der Fabrikarbeit in Beziehung setzt, erweist sich für eine Perspektive auf das in die Tradition der Kirmes gestellten Blockbusterkino als erwähnenswerte biopolitische Ergänzung: „Was der Lunapark in seinen Wackeltöpfen und verwandten Amüsements zustande bringt, ist nichts als eine Kostprobe der Dressur, der der ungelernte Arbeiter in der Fabrik unterworfen wird (eine Kostprobe, die ihm zeitweise für das gesamte Programm zu stehen hatte; denn die Kunst des Exzentriks, in der sich der kleine Mann in den Lunaparks konnte schulen lassen, stand zugleich mit der Arbeitslosigkeit hoch im Flor).“ (Benjamin 1939: S. 222 f.).
Adamov, Arthur (1955): Le pingpong.
Althusser, Louis (1970). „Ideologie und ideologische Staatsapparate. Anmerkungen für eine Untersuchung“. In: Ideologie und ideologische Staatsapparate.
Aufsätze zur marxistischen Theorie. Hamburg 1977, S. 108-153.
Asbell, Bernard (1963): „After Hours. The Inside of the Pinball Game“. In: Harper’s Magazine, Januar, S. 20-22.
Barthes, Roland (1957): „Adamov und die Sprache“. In: Mythen des Alltags. Frankfurt/Main 1964, S. 50-54.
Barthes, Roland (1970): Das Reich der Zeichen. Frankfurt/Main 1981.
Benjamin, Walter (1939): „Über einige Motive bei Baudelaire“. In: Illuminationen. Frankfurt/Main 1969, S. 201-245.
Benjamin, Walter (1936/38): „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“. In: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt/Main 2003, S. 7-44.
Caillois, Roger (1967): „Les appareils à sous“. In: Jeux et sports (= Encyclopédie de la pléiade, Bd. 23). Paris, S. 1124-1130.
Debord, Guy/Wolman, Gil (1956): „Mode d’emploi du d ́etournement“. In: Les Lèvres nues, Nr. 8, Mai 1956.
Eco, Umberto (1988): Das Foucaultsche Pendel. München 1989.
Färber, Helmut/Jenny, Urs/Roth, Wilhelm (1969): „Revolution im Privaten. Gespräch mit Rainer Werner Fassbinder“. In: Filmkritik. Jg. 13, Nr. 8, S. 471-476.
Fassbinder, Rainer Werner (1992): „Einer, der Liebe im Bauch hat (März 1971)“. In: Töteberg, Michael (Hg.): Rainer Werner Fassbinder. Filme befreien den Kopf. Essays und Arbeitsnotizen. Frankfurt/Main, S. 25.
Fo, Dario (1960): Gli Arcangeli non Giocano a Flipper.
Frady, Marshall (1972): „Memoir“. In: Playboy Magazine, Dezember, S. 159,164,241-243.
Göttel, Dennis (2014): „Flipper“. In: Marius Böttcher, Dennis Göttel, Friederike Horstmann, Jan Philip Müller, Volker Pantenburg, Linda Waack, Regina Wuzella (Hg.): Wörterbuch kinematografischer Objekte. Berlin, S. 52-55.
Hainz, Dieter (1970): „Päng. Crack. Klumm. Zoff. Flopp. Blip. Kläng. Zachapp“. In: Zeit-Magazin, 25. Dezember 1970, S. 20-23.
Handke, Peter (1990): Versuch über die Jukebox. Frankfurt/Main.
Heinz, Rudolf (1989): „Flipper-Fragment“. In: Wiener Festwochen (Hg.): Wunderblock. Eine Geschichte der modernen Seele (Katalog zur Ausstellung der Wiener Festwochen in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum der Stadt Wien, 27.04 bis 06.08. 1989). Wien, S. 675-678.
Heubach, Friedrich Wolfram (1972a): „Der Flipper. Essay“. In: Interfunktionen Nr. 9, S. 110-114.
Heubach, Friedrich Wolfram (1972b): „Zur allgemeinen Rede von der Sprache als Besonderem“. In: Sprache im technischen Zeitalter, Nr. 43, S. 241-244.
Heubach, Friedrich Wolfram (1982): „Der Flipper. Essay“. In: Polin/Rain (1982), S. 127-132.
Heubach, Friedrich Wolfram (1987a): Das bedingte Leben: Entwurf zu einer Theorie der psychologischen Gegenständlichkeit der Dinge; ein Beitrag zur Psychologie des Alltags. München.
Heubach, Friedrich Wolfram (1987): „‚Der Flipper‘-Automat oder Der Lauf der Dinge. Analyse eines gegenständlichen Weltmodells“. In: Ders.: Das bedingte Leben: Entwurf zu einer Theorie der psychologischen Gegenständlichkeit der Dinge; ein Beitrag zur Psychologie des Alltags. München: Fink, S. 167-173.
Horstmann, Ulrich (1990): Patzer. Zürich.
Kracauer, Siegfried (1926): „Kult der Zerstreuung. Über die Berliner Lichtspielhäuser“. In: Ders.: Das Ornament der Masse. Frankfurt/Main 1977, S. 311-317.
Manning, Peter K./Campbell, Bonnie (1973): „Pinball as Game, Fad, and Synecdoche“. In: Youth and Society. Jg. 4, Nr. 3, März, S. 333-358.
Meistermann-Seeger, Edeltrud / Bingemer, Karl (1971): Psychologie des Automatenspiels. Hrsg. von Deutsche Gesellschaft für Sozialanalytische Forschung e.V. Köln / Forschungsinstitut für Soziologie der Universität Köln. Köln.
Murakami, Haruki (1973): Pinball, 1973. engl. Übersetzung. Tokio 1985.
N.N. (1962): „François Truffaut im Interview“. In: Le Monde, 24. Januar 1962.
Oppitz, Michael (1974a): „Shangri-la, le panneau de marque d’un flipper. Analyse semiologique d’un mythe visuel“. In: L’Homme. Jg. 14, Nr. 3-4, S. 59-83.
Oppitz, Michael (1974b): Semiologie eines Bildmythos: der Flipper Shangri-La. Zürich 2000.
Parinaud, André (1959): „Truffaut: Le jeune cinéma n’existe pas !“ (Interview)“. In: Arts, Nr. 720, 29. April 1959, S. 1, 9.
Pasolini, Pier Paolo. „Von den Glühwürmchen“ (1975). In: Ders.: Freibeuterschriften. Die Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Konsumgesellschaft. Berlin, S. 104-111.
Peellaert, Guy (1967): „Pravda“. In: HaraKiri Januar.
Polin, Robert/Rain, Michael (1979): Wie man besser flippert! Tricks, Technik, Theorie. Köln 1982.
Polin, Robert/Rain, Michael (1979a): „Flipper und Zen“. In: Wie man besser flippert! Tricks, Technik, Theorie. Köln 1982, S. 122-126.
Reynolds, Daniel (2010): „The Pinball Problem“. In: Refractory Nr. 17 Juli. http://refractory.unimelb.edu.au/2010/07/18/the%C2%ADpinball% C2%ADproblem%C2%ADdaniel%C2%ADreynolds/ [24.11.2014].
Rossignoli, Marco (2000): The Complete Pinball Book: Collecting the Game and Its History. 3. überarbeitete Version. Atgen (PA) 2011.
Sadler, Simon (1999): The Situationist City. Cambridge (Mass.)
Schimank, Uwe (1999): „Flipperspielen und Lebenskunst“. In: Willems, Herbert/Hahn, Alois (Hgg.): Identität und Moderne. Frankfurt/Main, S. 250-272.
Simonetti, Gianni Emilio (1970): „Dedalus Pingames [it./engl.]“ In: Tilt. Vetrofanie per una archeologia popolare degli anni ’50 [Ausstellungskatalog Galleria Bréton, Mailand, 18.12. 1970 - 20.01. 1971]. Mailand, S. 3-11.
Vandeloise, Claude (1977): Flippers Stories. Paris.
Virno, Paolo (1998): „À l’époque du flipper“. In: Conjonctures Nr. 27, März, S. 81-87.
Warneken, Bernd Jürgen (1974): „Der Flipperautomat. Ein Versuch über Zerstreuungskultur“. In: Jürgen Alberts et al.(Hgg.): Segmente der Unterhaltungsindustrie. Frankfurt/Main, S. 66-129.
Yoon, Soyoung (2013): „Cinema against the Permanent Curfew of Geometry: Guy Debord’s Sur les passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps (1959)“. In: Grey Room Nr. 52, Juli, S. 38-61.